Die Webversion des gedruckten Journals finden Sie neben den hier aufgeführten Beiträgen hier.

„Alles anders, alles gleich“
Wie haben Sie als Künstler*in die Pandemie erlebt, wie und wo gelebt und gearbeitet? Womit haben Sie sich beschäftigt, worin Inspiration gefunden, wo vielleicht Trost? War alles anders, aber jeder Tag gleich? Oder doch vieles gleich und jeder Tag anders?
Besondere Zeiten sorgen für ebenso besondere Ideen. Ideen wie die Serie „Alles anders, alles gleich“. Jede*r Gastautor*in des diesjährigen Festivals erhielt dabei ein Stück leere Leinwand zur freien Gestaltung. Texte, Fotos, Skizzen oder Zeichnungen, Schritt für Schritt fügt sich all das zusammen zu einer großen Collage, die die Frage beantwortet: Wie sah und sieht sie aus, diese neue Welt nach dem 11. März 2020 nach dem Pandemiebeginn?
———
All different, all the same
As an artist, how did you experience the pandemic; how and where did you live and work? What did you occupy yourself with, what did you find inspiration in, where perhaps comfort? Was everything different, yet every day the same? Or were many things the same, yet every day different?
Special times allow for equally special ideas. Ideas such as the series “All different, all the same”, in which all guest authors at this year’s festival receive a blank piece of canvas. Filled with their contributions (texts, photos, sketches or drawings) it all comes together to form an extensive collage which seeks to answer the question: What has it been like, this new world after the start of the pandemic on 11 March 2020?
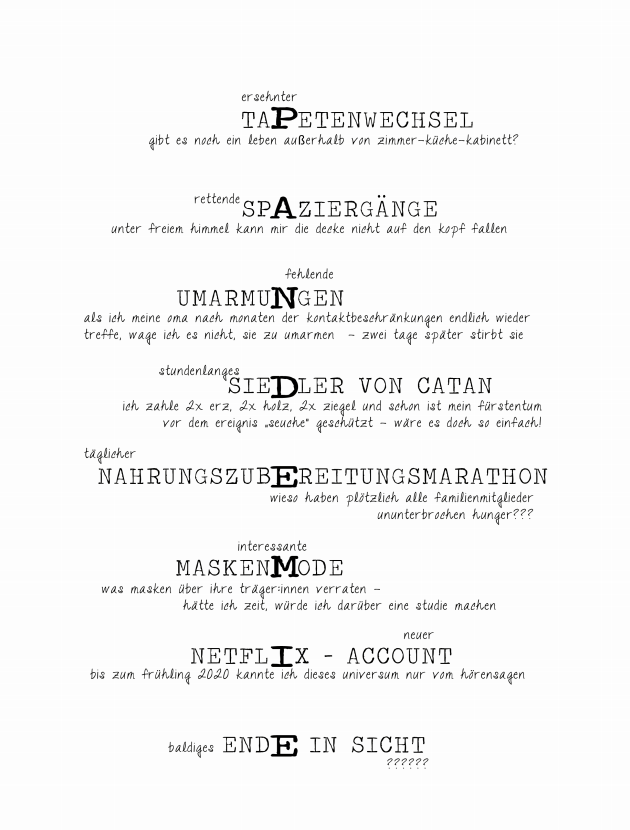
How do homeless stay home, stay safe?

Urs Mannhart
Im breiter werdenden Bachbett der Zeit hockte ich mich zu den Schafen, im Kopf den doppelten Doppelpunkt von Pythagoras:
«::».
Egal ob von oben oder unten betrachtet, von links oder von rechts, stets stehen zwei Punkte zwei Punkten gegenüber. Die perfekte Darstellung der Gerechtigkeit, sagte ich zu den Schafen. Sie nickten eifrig und verlangten nach mehr Heu.

Das Pandemiejahr
Gabriele von Arnim
Was haben wir uns ereifert über diejenigen,
die angeblich zu unvernünftig waren
und über die, die angeblich zu ängstlich waren.
Als hätten wir etwa gewusst, wie man sein sollte.
Vorsicht Umsicht Rücksicht
Hieß der Refrain in der Pandemie.
Denk an dich selbst
Und denk die anderen mit.
Wahrheit und Wirklichkeit
Lagen immer wieder im Clinch.
Es kratzte die große Ungewissheit an unsere scheinbar soliden Lebenstüren.
Es krabbelten alte Ängste grinsend hervor und wurden dreist.
Und auf einmal hatten wir
neben dem alten Ich auch noch ein KrisenIch
zu verkraften.
Wir brauchten Nähe und hielten Abstand.
Keine Umarmung, keine Haut, keine Hand.
Verletzbar sind wir wohl alle geworden.
Fühlten uns angegriffen und angreifbar,
Fühlten uns auf einmal ungeborgen.
Was wir vielleicht vorher schon waren
Aber jetzt wussten wir, was es war, das wir fühlten.
Wir haben gerempelt und gelernt,
gewütet und geweint,
uns verschlossen und geöffnet.
Verunsicherung gelebt. Umwege genommen.
Risiken und Chancen täglich abgewogen.
Sind müde geworden und ungeduldig.
Und jetzt?
Wings

My little patch might say:
John McWhorter
„During the pandemic, I decided to accomplish two milestones: to finally read War and Peace and to watch all eleven seasons of the sitcom The Jeffersons. I have completed the first, but not the second. I wrote a book about race issues that I likely would not have without the extra time alone and to think. I had become a single parent six months before the lockdown, and an unexpected benefit of the quarantine was that it was a great way to help form a new relationship with my daughters. Overall, I kept myself sane with a few unshakeable routines that gave the days a shape. Two were to work out every single day and to learn some Chinese every single day. I think I’ll stick with those for a while.“

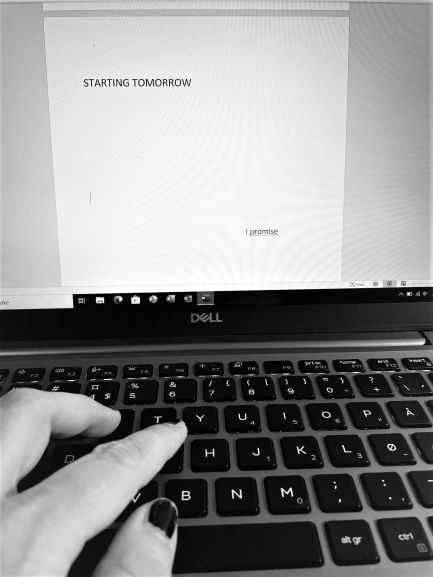
The Possibility of Renewal

Das Jahr der Füchse
Hilmar Klute
In Berlin waren, als weniger Menschen auf die Straßen gingen, die Füchse unterwegs, so als seien sie die eigentlichen Passanten dieser fantastisch verkorksten Stadt. Ihre wissenden und zugleich kindlich schüchternen spitzen Gesichter hat die eine oder andere Handykamera eingefangen, und sieh nur, wie die Füchse über das Straßenpflaster schweben – wie Fabeltiere! Wer in der Corona-Zeit kein Fuchs geworden ist, konnte nur verlieren. Ich habe das Fuchs-Sein in diesem Jahr von der Pieke auf gelernt. Am Anfang wusste ich, wo man abends Bier oder Wein aus Plastikbechern eingeschenkt bekam und welche Freunde noch frohgemut genug waren, mit mir auf Straßenpollern zu sitzen und über Bücher zu reden, die uns Glück und Erkenntnis bringen. Und das waren bestimmt nicht die Bücher, die von protzigen Nichtlesern empfohlen wurden, weil sie irgendwie etwas mit dem Leben in der Seuche zu tun hatten. Ja, ich habe mir beim Leben zugeschaut, mehr als früher. Und ich wollte eben in der Zeit, die vor mir lag, nicht dumm und traurig oder zornig werden, sondern klug und zukunftsfroh. Da alle an der Zukunft zweifelten, wollte ich für die Zukunft ein Feuerwerk entzünden, und dass Silvester ein Knallkörperverbot herrschte, war mir nur recht. Im Februar bin ich dann Vater von Zwillingen geworden. Ihre Geburt war schwer, und sie ging glücklich aus. Spät in der Nacht verließ ich die Klinik und sah auf dem Gelände einen großen Fuchs durch die Grünanlage schweben, dorthin, wo er zu Recht die Küche vermutete. Ich lief dem Fuchs hinterher und machte ein Handyfoto. Als ich es anschaute, war dort nur ein bisschen verwackelte Dunkelheit zu sehen. Vom Fuchs keine Spur. Aber seine Botschaft habe ich, während ich mich durch den einsamen dunklen Volkspark Friedrichshain auf den Heimweg machte, ganz gut verstanden: Sei kein Idiot. Sei froh, dass bei dir am Ende dieses komischen Jahres ein neuer Anfang steht, ein doppelter Anfang sogar. Bleib also ein Fuchs und jage nicht den falschen Sensationen hinterher.
Club de Lectura. Sesión #63
Maria José Ferradas
Cada viernes a las 20:30 mi padre, Motoko y yo hacemos una video llamada y nos leemos un poema. El encuentro dura entre media hora y cuarenta minutos.
Este viernes mi padre, un vendedor viajero jubilado que vive en el sur de Chile, ha elegido uno de los Salmos de Ernesto Cardenal. Motoko, escultora japonesa especialista en el tallado de pequeños animales, leerá a Shuntaro Tanikawa y yo un poema en prosa de Gabriela Mistral dedicado a la luz de las lámparas.
Terminada la lectura mezclamos sonidos e imágenes en nuestra mente: pobres del mundo que, según el poeta nicaragüense, algún día tendrán un banquete; seres que de un modo improbable –“dos mil millones de años luz de soledad” siguiendo el cálculo de Tanikawa–han logrado encontrarse; una lámpara que con su mirar humanizado llena la noche de una habitación.
“Somos el club de lectura más pequeño del mundo”, bromeamos antes de despedirnos.
*Al momento de escribir este texto calculo que nos hemos reunido sesenta y tres viernes y leído casi doscientos poemas.

I Sit, Therefore I Am
Etgar Keret
When I’m running around trying to get things done,
I’m living in time, but don’t feel it’s on my side.
But when I sit down on a bench and leave room for it next to me,
time stops being a taskmaster and becomes a friend.
We sit together and gloat while people whistle past us
like bullets about to miss their target.
I offer time a cigarette, but he refuses.
He’s very careful about his health, you know.
He wants to live forever.
Translated by Sondra Silverston
Lockdown enriched my life
Roger Garside
For my wife and me, unlike many others, the two periods of “lockdown” since March 2020 have been an overwhelmingly positive experience.
Soon after lockdown began, the University of California Press awarded me a contract to publish my new book China Coup: The Great Leap to Freedom. The shut-down of London’s live culture meant that it could not compete for my time. I raced to revise the text for submission of the final manuscript, adding a chapter about China’s COVID-19 cover-up and updating other parts of the book to take account of dramatic changes within China and in its relationship with the world.
Thank heavens this pandemic occurred in a digital age. Through the internet, I drew on sources of information from around the world and exchanged views daily with experts on four continents. Zoom also has been lifeline. In a single week, it took me first to California then to New York for book presentations. It enabled me to keep in close touch with my three adult daughters. Indeed, it drew me closer to one of them allowing us to meet five times a week to chat and share YouTube recordings of a wealth of songs from many countries, many decades, and genres. By Zoom, I did two online acting courses, and by Zoom my wife and I did two hours of Pilates each week, marvelling how closely our instructor could monitor our performance. These exercises and daily walks allowed me, at the age of 83, to end lockdown fitter than I began.
When my usual place of worship closed, I went online and discovered at St. Bride’s, Fleet Street, “the journalists’ church”, online services with outstanding preaching, prayer, and music. I found a new spiritual home.
Not all our discoveries have been online. On daily walks, we explored the streets of our South London neighbourhood, learning their history, studying their architecture, and observing how their occupants love or neglect their homes, or, strolling through the parks with time on our hands, we have watched more closely flowers coming into bloom and leaves unfolding, and listened more attentively to the song of birds.
Marko Martin
Erster Januar 2020 in Hongkong, die letzte freie Großdemonstration in der Stadt. Neben mir der Demokratieaktivist Joshua Wong, der nun bereits seit einem Jahr in Gefängnishaft ist. Bereits damals aber, in jenen ersten Tagen des neuen Jahres, war in den zu dieser Zeit noch unzensierten Medien von einer seltsamen Lungenkrankheit zu lesen gewesen, die in einer festlandchinesischen Stadt namens Wuhan ausgebrochen sei. Und so, wie das KP-Regime anfangs vertuschte, verleugnete und verschwieg, so effizient betrieb es gleichzeitig die Auflösung der Autonomie in Hongkong voran, das Ende der bislang garantierten Bürgerrechte.

Floreció la quila
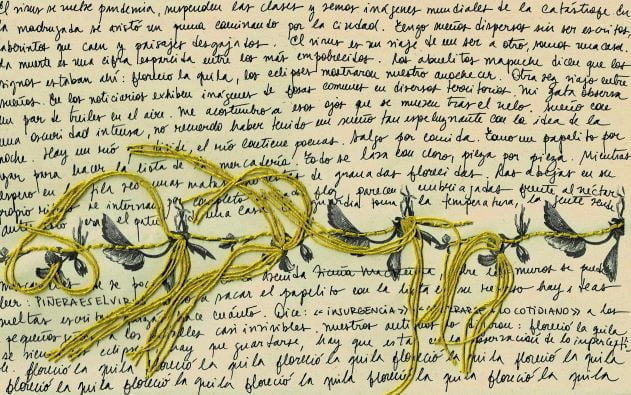
Kaskade
Matthias Nawrat
Hellgrüne Spitzen ragen
über die Dächer meiner Straße.
Das Haus gegenüber verdeckt den Stamm des Baums,
in den äußersten Fortsätzen der Peripherie
vollzieht sich die Verwandlung.
Im Haus wohnt der junge Schauspieler
aus „Als wir träumten“,
steht mit nackter Brust auf dem Balkon,
die Familie aus Irak: die Frau raucht,
putzt die Wand, das Mädchen hängt Wäsche auf.
Im Parterre vier Bauarbeiter aus Bulgarien auf Plastikstühlen,
schreiben Nachrichten nach Hause, rauchen, schauen auf die Kreuzung.
Von meinem Balkon aus sichtbar:
die hellgrünen Spitzen, eingepackt
in steinalte Häute von schlafenden Fledermäusen,
Baustellen, Projekte nach innen – ein Flugzeug sinkt
auf die Stadt herab, die Raumzeit krümmt sich, dehnt sich
wieder aus. Ich denke: Kaskade,
dabei geschieht das alles jetzt,
im Zeitalter des Megastaus.
Das Haus verdeckt den Stamm
des Baums.
See, dream, flee despite the walls


Dream Big
Nana Oforiatta Ayim
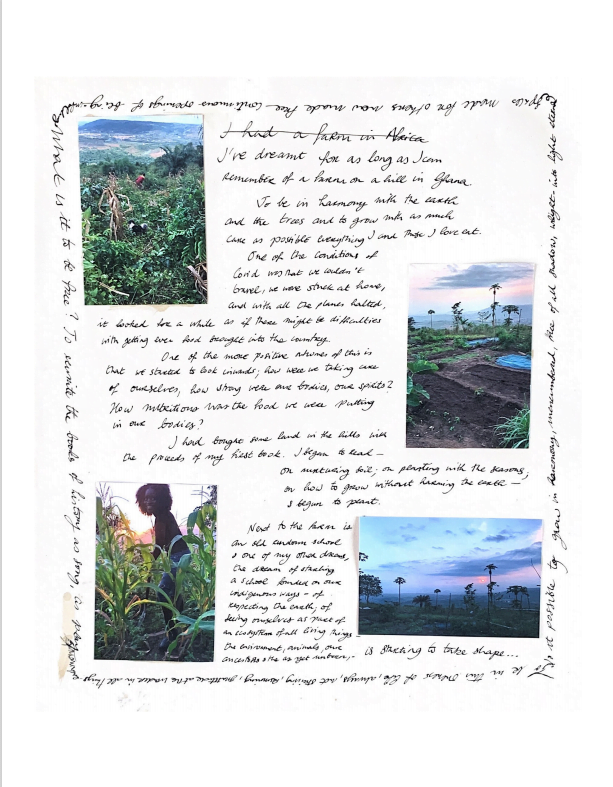



Arnon Grünberg
‘We could’ve gone as far as Albany,’ captain Sam says, ‘But not in april.’
We turn around. The Hudson is so wide that she sometimes resembles a lake, the villa’s along the river seem to be scattered there by frivolous gods. In Europe these riversides would be decorated with café terraces. Here the tourist is obsolete. Only an old lighthouse serves as a bed & breakfast.
At Rogers Island we are caught in a snowstorm.
The boat is dancing. Captain Sam mutters, „An insane adventure.“
We moor at Kingston.
„Did you find what you were looking for?“ Asks Sam.
„I have found those who are deceived and who never want to be deceived again. But who is deceiving whom? „
On a quiet street in Kingston next to the Yum Yum Noodle Bar, Adam Bernstein receives clients, he talks to the dead.
His spacious office is empty except for one table.
„All children are seers,“ says Bernstein, 63, „but most children don’t do anything with it. I grew up on 36th Street in Manhattan in a neighborhood called Murray Hill. „
„I live near there,“ I say.
Bernstein nods, as if he already knew that.
„Anyone can learn to play the piano. In the same way everyone can learn to talk to the dead. I make a living from it. Energy becomes image. My brother died in 1998, after which I discovered my skill. Slowly I learned to be grateful. „
Bernstein hardly moves while talking.
„I am not against the vaccine,“ he says. „I am pro-choice. The profit margins are great, the need to control us is immense. „
„What kind of teenager were you?“ I ask.
„A lot of pot smoking,“ says Bernstein, „every high is followed by a downer, if you realize that you know enough.“
“You were going to talk to my dead,“ I say cautiously.
Bernstein concentrates.
„I see your mother,“ he says, „a little brown dog.“
„Did my mother become a little brown dog?“
„I wouldn’t go that far,“ Bernstein replies, „but there is a dog that feels when she’s there. She is often there. „
We say goodbye.
„Are you by any chance related to the famous Bernstein?“ I ask.
„You have a lot of American Bernsteins,“ he says. „I am the not famous Bernstein.“
I turn around at the door. He is still motionless behind his desk.
This Bernstein believes in few things, I suspect, certainly not in conspiracy theories. He only knows that the living human desperately longs for his dead.
Part of a series of articles published in the Dutch newspaper Trouw and the Belgian newspaper De Standaard about paranoia in contemporary politics and culture.
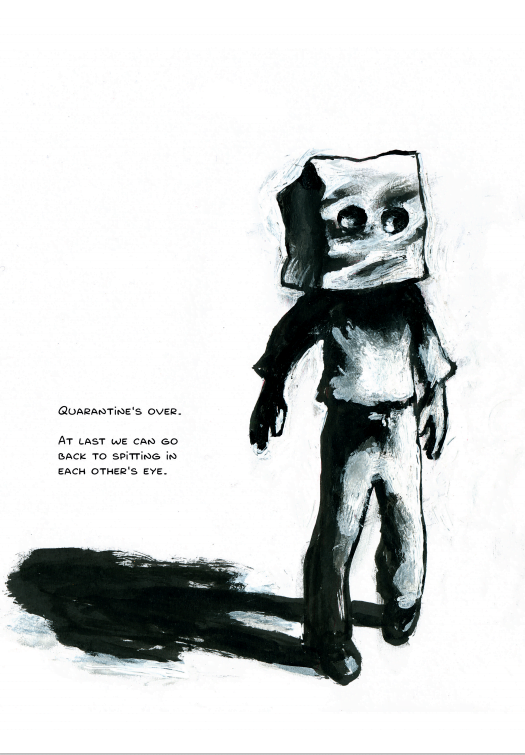
Wie hat sich Ihr Leben mit Corona verändert?
Tilman Sprengler
Ganz der Alte,
sagt sie,
du bist doch ganz der Alte
und jetzt erst recht.
So ein sanftes Wort:
Klimawandel,
denkt er,
wie der vom Wasser
launisch umspielte Stein.
Ansagen, Absagen
Aber bitte durch Masken,
rufen wir,
Wahrheiten
Sind unsere Kryptowährungen.
Da wird schon was gehen.

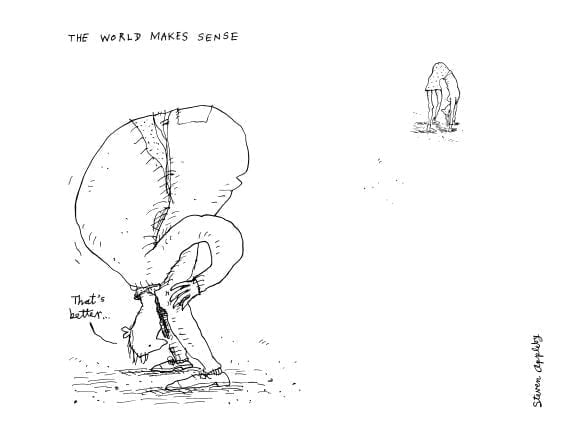
Viktor Jerofejew
Covid-19 – das ist der Spiegel der kollektiven Seele der Menschheit im 21. Jahrhundert. Die Pandemie und die Menschen ähneln sich in ihrer Unberechenbarkeit, Grausamkeit und Hinterhältigkeit. Als die Welt mit der Pandemie konfrontiert wurde, dachte ich, die Menschen würden sich zusammentun und gemeinsam gegen die Krankheit angehen.
Welche Enttäuschung!
Es begann ein Wettrennen um Impfstoffe, ein Bacchanal des Egoismus, der Feigheit und Gemeinheit. Die Kühllaster New Yorks und die ewig brennenden Scheiterhaufen Indiens haben uns nichts gelehrt. Niederträchtig wurden alle Spuren verwischt, die Wissenschaftler schweigen sich darüber aus, wo dieses Corona-Virus hergekommen ist. Die Rückkehr in eine normale Welt gibt es nicht. Ich setze mich ins Auto und fahre auf meine Datscha bei Moskau… Mir sind die Bäume und das Flüsschen mit den Fischen darin lieber als die Menschen.
Aus dem Russischen übersetzt von Beate Rausch

Kiran Millwood Hargrave
And written in the hymnary of things I´ve learned is love, my whole body rapt intransmutation by hands I´ll never know – is this faith? To keep it cloe though it burns and twists to be free? It is a bravery I never knew I had, to have and never hold.
My lesson taken by heart:
No need exists so sacred it
Cannot be left unanswered as prayer.
Consider me schooled.
Consider me chuched.


Susin Nielsen
I walked a lot during the first four months of the pandemic, when the world shut down. One day, blocks from my house, on a cold and rainy Vancouver day, I saw a woman lying on her tiny porch, a hand tossed over her face, looking exhausted.
To me, it told a whole story, of the spouse and children inside the cramped home, everyone on top of one another, everyone making demands on her. This was the one place where she could find a moment to herself, to be with her own thoughts. It made me think of an Alice Munro short story. It could have all been a fiction in my head, of course – but then again, that’s a writer’s life, isn’t it? It encapsulated the daily mundane struggle of the pandemic. During the first four months of lockdown, low-grade anxiety meant I couldn’t write. On a whim one day I started a Poetry Tree outside my house; I put up a new poem (none written by me, but by a mix of well-known and not-so-well-known poets) every week. It became a conversation starter. People in our neighbourhood stopped and read the poem. Some people even drove from further afield to read that week’s offering. I soon hung up a poem for the younger set as well. It was a lovely way to connect with our community, and because most people truly had nowhere else to go, they took the time to really appreciate the poems.
ES WIRD KEIN BLUT FLIESSEN
Lídia Jorge
Und was, wenn es der Riss ist, der die Wand stützt?
Grafitti, 21. Jh.
1.
Beim Schreiben dieser Zeilen denke ich an das italienische Kind, das vor Freude in die Hände klatschte, weil es gesehen hatte, dass die Flugzeuge auf dem Flughafen stillstanden und dazwischen Hasen hoppelten und Vögel Nester bauten. Der Junge war vielleicht fünf Jahre alt. Es war mitten im Pandemie-Frühjahr, Italien verzeichnete so viele Sterbefälle, dass sie nicht wussten, wie sie die Toten beerdigen sollten, der Besitzer eines Bestattungsunternehmens sagte erschüttert, niemand kümmere sich um die Leichen und ihm bleibe einzig als liebevolle Geste den Verstorbenen gegenüber, ihren Kopf auf ein Kissen zu betten, als wären sie seine eigenen Angehörigen. Unterdessen klatschte der Fünfjährige in die Hände, weil jetzt nicht mehr so viel Kohlendioxid ausgestoßen würde und bald sämtliche Erdölbohrungen gestoppt werden könnten.
Dass das Kind vermutlich in seiner umweltbewussten Familie gelernt hatte, worum es ging, versteht sich. Beeindruckender aber war, dass die Freude des Jungen über die Ereignisse zu einem Symbol wurde. Er war die Zukunft, die auf die Gegenwart wie auf einen in der Geschichte bereits vollzogenen Schritt blickte. Mit seinem Youtube-würdigen Auftritt verabschiedete sich der Junge, geboren im Jahr 2015, von der Vergangenheit, die wir verkörpern, wir, für die das Jahr 2020 das Jahr einer von einem Coronavirus ausgelösten Pandemie ist. Und ich dachte an den Film There Will be Blood von Paul Thomas Anderson, basierend auf dem Buch Oil! von Upton Sinclair. Ich dachte an die Figur Daniel Plainview, gespielt von Daniel Day-Lewis, sah ihn wieder vor mir mit träumerischem Blick angesichts der ersten Erdölfontäne.
Ich dachte an diesen Film und an dieses Buch, denn beide schildern den Beginn der Gier nach dem fossilen Brennstoff, die im Laufe des 20. Jahrhunderts die ganze Welt gepackt hat und den Impuls zu einer so ungeheuer großen Veränderung gab, dass es möglich war, innerhalb von hundert Jahren das Gesicht der Welt sowie auch das Leben der Menschen zu verändern und ihnen einen Komfort zu bescheren, wie man ihn sich nie erträumt hatte. Doch zugleich, folgt man Sinclairs Erzählung, einen Impuls, der nicht nur keine Möglichkeit bietet, neue Tragödien zu verhindern, sondern dem auch die Möglichkeit innewohnt, unsere Spezies an den Rand ihrer Vernichtung zu bringen. Das ist das Dilemma, vor dem wir heute stehen. Das Virus hat nur erhellt, in welchem Zustand wir sind, so als befänden wir uns auf offenem Gelände und bewegten uns im Licht eines Blitzes.
2.
Im grellen, gespenstischen Licht unseres aufgerüttelten Bewusstseins betrachtet, sieht die Pandemie wie die Rache dafür aus, dass wir seit dem 18. Jahrhundert die Ressourcen der Erde leichtfertig ständig weiter ausgebeutet haben, bis sie unwiderruflich erschöpft waren. Das Virus, dieses winzige Partikel einer Materie, die sich auf wundersame Weise über unseren Körper reproduziert, führt uns nun, als wäre es ein erzürntes anthropomorphes Wesen, mit dem auf dem ganzen Planeten von ihm verursachten Chaos vor Augen, dass bei der Verteilung von Reichtum schreiende Ungerechtigkeit herrscht und von den sieben Milliarden Menschen, die auf der Erde leben, die Mehrheit vom Fortschritt ausgeschlossen bleibt.
Als besäße das Virus politische Weisheit, legte seine Ausbreitung bloß, auf welche Weise Demokratien leichte Beute der zu blutigen Auseinandersetzungen führenden, auf egoistischen Absichten basierenden extremistischen Bewegungen werden konnten, die wiederum eine kompromisslose Apologie archaischster Nationalismen zur Folge hatten. Nationen, die sich damit rühmten, zum great again zurückzukehren, glichen sich letztlich nicht durch das Virus, aber dank seiner Auswirkungen den ärmsten Ländern an, indem sie demonstrierten, dass auch ihre Elenden betteln müssen und ohne Beistand sterben. Primitive Anführer, aus den unkultivierten Höhlen der neuen Moderne hervorgekrochen, ließen unmissverständlich erkennen, dass sie innerlich der Steinzeit angehören. Und nebenbei erlaubte das Virus, reine organische, vom elementaren Überlebensprinzip geleitete Materie, den Nachweis, dass es sich bei Margaret Thatchers Grundsatz, es gäbe keine Gesellschaft, sondern nur Individuen, letztlich um eine aus Krämerrechnereien resultierende Sackgasse handelt, die den Momenten der Prosperität dient, sie langfristig aber untergräbt und vor allem uns darauf vorbereitet, dass wir aneinander geraten, wenn eine Katastrophe naht.
Die derzeitige Situation beweist nur zu nachdrücklich, dass Albert Camus noch immer recht hat mit der Forderung, wenn wir schon allein sind auf der Erde, sollten wir wenigstens Brüder sein. Und das ist der Grund, warum wir vermutlich in eine neue Zeit eintreten, mit der das Jahrhundert des Oil! endet, eine neue Epoche, die noch keinen Namen hat, deren Konturen sich jetzt aber deutlicher abzuzeichnen beginnen als vor einem Jahr. Vorläufig werden wir, allein im Weltraum, zweifellos von der Energie der Wellen, des Windes, des Sonnenlichts, des bestellbaren Ackers, des Waldes leben, das heißt, wir werden auf der Erde bleiben, damit die Menschheit überlebt. Kurios also, wie die Natur durch eine Metapher in die Geschichte eingeht.
3.
Und deshalb ist dies paradoxerweise ein Moment der Hoffnung. Ein Blatt Papier reicht nicht aus, um alle Anzeichen aufzuzählen. Nie zuvor haben sich die Medizin, die Wissenschaften und die Technologie so zusammengeschlossen wie in diesen Tagen, um gegen ein globales Problem solcher Dimension zu kämpfen, und nie zuvor haben wir so deutlich gespürt, dass jene, die für uns sorgen, uns so nahe stehen. Nie zuvor war die Technologie so hilfreich, wobei aber der Stolz auf ihre Effizienz zugleich im Kontrast zur Gefährlichkeit ihres unkontrollierten Einsatzes gestanden und nach einem Bündnis mit humanistischer Kultur verlangt hat, das ihr Deontologie, Ethik und Daseinsberechtigung verleihen sollte.
Und noch nie zuvor ist so unmissverständlich deutlich geworden, dass Kunst und Kultur für das Leben der Menschen von existentieller Bedeutung sind. Gut möglich, dass dieser von staatlicher Seite stets stiefmütterlich behandelte Bereich jetzt zeigen kann, wie unverzichtbar er ist, wenn man der Tragödie, die ihn getroffen hat, gegenüberstellt, wie sehr er uns allen fehlt. Gut möglich, dass selbst das dank des großen digitalen Kehrbesens in Lebensgefahr schwebende Buch nach diesen langen quälenden Monaten im Grunde längst Bekanntes überdeutlich bewiesen hat: dass es unverzichtbar dafür ist, subjektive Menschlichkeit herauszubilden, die Haltung und Mitgefühl praktiziert und uns lehrt, Schönheit als Schwester der Wirklichkeit zu begreifen. Sein Potenzial, Frieden zu fordern, ist unsichtbar und dennoch unermesslich groß. Die Lehre aus der heutigen Zeit besteht darin, dass diese Forderung sein Leben lang wesentlich sein wird für den fünfjährigen Jungen, der in die Hände klatscht, weil er eine neue Welt erahnt. Er wird fraglos einer Generation angehören, die dem Weg mit einer Inschrift folgen wird, die besagt: Es wird auf Erden kein Blut fließen. Der Junge weiß es noch nicht, aber schon bald wird er wissen, dass dies der Schutzbrief ist, den wir ihm als Erbe hinterlassen. Das haben wir im grellen Licht eines Blitzes begriffen.
Der Text wurde in Spanien am 24. Dezember 2020 in „El País“ veröffentlicht.
Aus dem Portugiesischen von Karin von Schweder-Schreiner.






Folding
Wendy Law-Yone
The year of living pandemically, as I think of it now, remains impossible to clock. When did it actually begin? For me it began, I believe, with a fire. The image of Notre Dame cathedral going up in flames first arrived on my phone on 15 April 2019 with a message from a friend in Paris: ‘We were across the Seine and watched the whole thing. Just unspeakable. l will be forever changed.’
In less than a year, much of the world would feel forever changed. Covid 19 was here to stay. Looking back, I find myself pinpointing the spectacle of the great cathedral in flames, spewing what looked a lot like fire and brimstone to me, as both an augury and a harbinger of the pandemic to come.
The elasticity of time is only one among the myriad of clichés spawned by Covid-19. Here’s another: the relativity of tragedy. We all have our problems, in other words; some of them can make even a plague pale into insignificance. The dementia of an aged parent; the death of a loved one; a sudden stroke; a brain tumour; a mental breakdown … the beat goes on in our daily lives, pandemic or no pandemic. ‘Men die and worms eat them,’ to paraphrase Shakespeare, ‘but not only from Covid.’
My own pandemic-time has been dominated by two competing distractions: the move to a new home in one of the most beautiful corners of the world (Provence), and the outbreak of a revolution in my homeland (Burma/Myanmar), one of the most beleaguered countries on earth. The first has been altogether benign; the second altogether heart-breaking. Together these wildly disparate demands on my attention have erased any shred of concentration that might have remained for the business of writing.
Yet failing to write does not mean ceasing to think about writing. Having set aside the pre-pandemic novel I had on the boil, I keep returning instead to a long-dormant work-in-progress: a meditation on folding. Yes, folding – as in laundry, as in origami, as in geology.
Long before Marie Kon’s tutorials on how clothes should be folded (with joy!) so they can be stood on their edges in drawers, not laid flat on their backs the old lumpen way, it was a compulsion of mine to fold with military precision anything in sight that wanted folding. I folded everything from asymmetrical ankle socks to elasticised sheets, from slippery underwear to bulky blankets. I folded not only clothing and bedding but paper as well: newspapers, gift-wrap, ribbons and strings included. I folded and refolded my own napkin, paper or cloth, at restaurants, dinner parties, and take-away spreads.
This preoccupation with folding, once a mild domestic compulsion, now probably curable only through shock treatment, has provided the central trope, the leitmotiv, of the book I am currently not writing. In this ever-expanding opus, the protagonist, a veteran of pointless speculation, gazes deeply into the abyss of folding trivia. She learns, for example, that the exquisite art of origami was not a Japanese invention but an idea imported from the West, where elaborately folded napkins graced the dinner tables of 17th– and 18th-century nobles. She learns, significantly, that the same principles underpinning napkin folding were further developed by one Friedrich Fröbel, the 18th-century German pedagogue and founder of the kindergarten. The same Fröbel goes on to specialise in minerology, and his eloquence on the subject of rocks transports her into the realm of tectonic origami.
Here at last, in the liminal space between a rock and a hard place - where ‘nature and man,’ as Fröbel saw it, ‘seemed to me mutually to explain each other’ – universal truths are revealed. Geologic formations, like certain human specimens, will, under compressional stress, bend instead of break, folding in on themselves like so many wet blankets. Over time, they will collapse into a number of well-defined patterns: recumbent, disharmonic, parasitic, slumps.
Ah, so folding is just controlled collapsing, the protagonist thinks, returning to her favourite displacement activity. She picks a square of lint off a freshly laundered napkin. As she folds the fragment into an ever-diminishing series of triangles, she remembers a story, an origami story, in which both history and advanced weaponry unfold from flat paper constructions, the skies blooming in war time with ‘bombers and kestrel-shaped shadows’. The story begins and ends with the same lines:
It is not true that the dead cannot be folded. Square becomes kite becomes swan; history becomes rumour becomes song. Even the act of remembrance creases the truth.
Voilà! In the palm of her hand lies a microscopic crane, composed entirely of lint.
Have I lost the plot? Will you buy the book anyway?

©Wendy Law-Yone
A time for uncertainty
Athena Farrokhzad
There is a time for everything under the sun
A time for birth, a time for death
A time for proximity, a time for distance
A time for recommendations, a time for restrictions
A time for immunity, a time for loneliness
A time for embrace, a time to abstain from embraces
A time to travel, a time for travel prohibition
A time for quarantine, a time for gathering
A time for sanitizers, a time for spreading
A time for savings, a time for crisis packages
A time for volunteers, a time for visors
A time to throw stones, a time to gather stones together
A time to obtain and stitch
A time to tear apart and loose
A time for certainty, a time for uncertainty
Kitchen Window


Akademiker*innen sind um ihre Freiheit besorgt
Manche von ihnen fürchten um ihre Karriere, weil sie nicht an progressive Dogmen glauben.
John McWhorter
Infolge der antirassistischen Proteste, die sich in unserem Land zurzeit erheben, ist eine unzusammenhängende, aber eingeschworene Gruppe von Menschen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt. Diese Menschen sind der Auffassung, dass soziale Gerechtigkeit nur erreicht werden kann, wenn alle politischen Positionen, die keine hinreichende Opposition gegen Machtungleichheiten erkennen lassen, aus der Öffentlichkeit verbannt werden. Die Arbeit von Intellektuellen und Künstler*innen hat dieser Auffassung zufolge nur dann eine Berechtigung, wenn sie an vorderster Front gegen die Vorherrschaft der Weißen ankämpft. Von weißen Menschen wird erwartet, dass sie ihre Mitschuldigkeit an der weißen
Vorherrschaft anerkennen, beseitigen und gleichzeitig davon ausgehen, dass es sich hierbei um eine unabschließbare Aufgabe handelt. Verlautbarungen, die dieses Projekt infrage stellen, werden als Form der »Gewalt« angesehen, die an den Pranger gestellt und der Gesellschaft ausgetrieben werden muss.
Kritiker*innen haben dieses Projekt als »Cancel Culture« bezeichnet. Deren Vertreter*innen haben dieses Label zuletzt allerdings von sich gewiesen. Ziel sei es weniger, die gesamte Existenz eines Menschen zu vernichten – was ohnehin so gut wie unmöglich sei –, sondern es gehe darum, Kritik um irgendeine Form von Bestrafung zu erweitern. Im Juli etwa hat eine Gruppe von Sprachwissenschaftler*innen eine Petition an die Linguistic Society of America übermittelt. Nicht nur kritisieren die Unterzeichner*innen den Sprachwissenschaftler und Psychologen Steven Pinker für seine als rassistisch und sexistisch wahrgenommenen Äußerungen, sie fordern darüber hinaus, Pinkers Mitgliedschaft in der Linguistic Society of America solle suspendiert und sein Name von einer Liste entfernen werden, auf der Verbandsmitglieder verzeichnet sind, die sich den Medien als fachkundige Ansprechpartner*innen zur Verfügung stellen. Ein Hinweis darauf, dass viele einflussreiche Akteur*innen die Geisteshaltung, die einer solchen Aktion zu Grunde liegt, bereits verinnerlicht haben, ist die Tatsache, dass Bestrafungsklauseln wie im Fall dieser Petition als selbstverständlich und gerecht und nicht als das neue zensorische Addendum angesehen werden, um das es sich hier handelt.
Zudem wurde behauptet, eine solche Form der »Cancel Culture light« sei unbedenklich, da sie keine ernsten Folgen habe. Nachdem ich mit 152 weiteren Intellektuellen in »Harper’s Magazine« einen offenen Brief unterzeichnet hatte, in dem wir uns für das Recht auf freie Meinungsäußerung aussprachen, hielt man uns entgegen, wir seien doch nur wohlhabende Prominente, die nicht kritisiert werden wollen – so als seien lediglich ein paar Leute zurechtgewiesen und nicht etwa an den Pranger gestellt und ihrer Posten enthoben worden.
Auch wenn die neuen Progressiven anerkennen, dass einige Prominente zu Unrecht geteert und gefedert worden sind, darunter die Kochbuchautorin und Internetpersönlichkeit Alison Roman, der Datenanalyst David Snor und Gary Garrels, Chefkurator am San Francisco Museum of Modern Art, bestehen viele von ihnen darauf, dass es sich bei den genannten Fällen um einmalige Verirrungen handelt und nicht so sehr um Symptome einer grundlegenden kulturellen Zeitenwende.
Im Juli habe ich getwittert, dass mein »Bloggingheads«-Sparringpartner Glenn Loury und ich seit letztem Mai nahezu jeden Tag Zuschriften von Lehrenden bekommen, die aufgrund der Tatsache, dass ihre Meinungen mit den Geboten der woken Community inkompatibel sind, um ihre Posten fürchten. Daraufhin wurde mir von verschiedener Seite unterstellt, ich würde lügen. Niemand, der auch nur annähernd bei Verstand sei, hieß es, habe etwas Derartiges zu befürchten.
Die Fakten legen etwas anderes nah. Die Heterodox Academy hat unter 445 Akademiker*innen eine interne Mitgliederumfrage durchgeführt: »Stellen Sie sich vor, Sie äußern am Arbeitsplatz und in Gegenwart von Fakultäts- oder anderen Kolleg*innen Ihre Meinung zu einem kontroversen Thema – würden Sie mögliche Konsequenzen befürchten?« 32,68% bzw. 27,27% der Befragten gaben an, sie wären »sehr besorgt« bzw. »extrem besorgt«, in der Folge »ihren Ruf zu schädigen«, und 24,75% bzw. 28,68% der Befragten gaben an, sie wären »sehr besorgt« bzw. »extrem besorgt«, ihre »Karriere könnte darunter leiden «. Mit anderen Worten: Mehr als die Hälfte der Befragten waren der Ansicht, dass es ihre Karriere durchaus in Gefahr bringen könnte, wenn Sie in einem akademischen Kontext Meinungen zum Ausdruck bringen würden, die kein Konsens sind.
Es muss also niemand erstaunt sein oder Unglauben darüber äußern, dass mir immer mehr Menschen schreiben. Im Frühsommer dieses Jahres habe ich innerhalb von drei Wochen ca. 150 solcher Zuschriften erhalten. Was in diesen Zuschriften zum Ausdruck kommt, ist eine alles andere als irrationale Angst unter jenen, die von den Dogmen der woken Linken abweichen – wenn auch nur geringfügig – und dies zum Ausdruck bringen.
Das Ausmaß der Besorgnis unter den Akademiker*innen, die mir schreiben, ist erschütternd. Es handelt sich im Übrigen nicht ausschließlich um Mitglieder des akademischen Mittelbaus. (Da mich die Zuschriften privat erreichen, kann ich hier keine Namen nennen.) Ein Professor schrieb: »Trotz meiner Professur und meines Ansehens mache ich mir Sorgen, dass Student*innen gegenstandslose ›Title IX‹-Verfahren[i] gegen mich anstrengen […], mich boykottieren oder sogar versuchen, mich von meinem Posten entfernen zu lassen.« Ich habe keinen Anlass zu glauben, dass der Autor dieser Zeilen übertreibt, denn genau das, was er beschreibt, ist seine*r Vorgänger*in passiert.
Ein*e Statistikprofessor*in schreibt:
Ich thematisiere in meinen Kursen regelmäßig, dass es sich um einen Fehlschluss beziehungsweise um eine spezifische Form der Verwechslung von Korrelation und Kausalität handelt, wenn man davon ausgeht, dass Ungleichheit Diskriminierung impliziert. Aber offen gestanden habe ich inzwischen Angst, solche Themen anzusprechen […], denn dieser neuen Religion zufolge ist Ungleichheit ein klarer Beweis für Diskriminierung.
Bis in die Mediävistik ist dieses Klima vorgedrungen: Ein*e Assistenzprofessor*in berichtet davon, die Attacke einer Gruppe von Wissenschaftler*innen überstanden zu haben, die sich, »sobald sie es auf jemanden abgesehen haben, unfassbar niederträchtig und hinterhältig verhalten« und die regelmäßig »PR-Kampagnen anstrengen, um zu erreichen, dass andere Wissenschaftler*innen oder Student*innen entlassen bzw. exmatrikuliert und aus akademischen Programmen bzw. Forscherzusammenschlüssen entfernt werden – oder um Leute einfach nur mundtot zu machen.«
Wer nicht weiß ist, kann sich in diesem Umfeld nur so lange sicher wähnen, wie er*sie sich anpasst. Ein*e Assistenzprofessor*in of color schreibt: »In beruflicher Hinsicht beunruhigt mich zurzeit nichts mehr als dieses Klima« und betont: »Die Wahrheit ist, dass ich in den letzten Jahren durch diese zur Normalität gewordene Intoleranz und den Social-Justice-Kult stärker marginalisiert worden bin als durch jede Form von Rassismus, der ich in meinem Leben je ausgesetzt war.«
Die Vorwürfe, mit denen sich viele dieser Professor*innen konfrontiert sehen, gründen auf einer fanatischen Weltsicht, deren Anhänger*innen sich über jede Äußerung hermachen, die als Ausdruck »weißer Vorherrschaft« interpretiert werden könnte. Dabei sind die Ankläger*innen ernsthaft davon überzeugt, im Besitz einer höheren Wahrheit zu sein. Ein weißer Professor hat im Unterricht Ausschnitte aus einem Interview mit einem prominenten schwarzen Intellektuellen zitiert, der die Hip-Hop-Gruppe N.W.A. erwähnt. Der Professor hat nebenbei darüber aufgeklärt, wofür die Abkürzung steht, weil diese Gruppe nur noch wenigen Studierenden ein Begriff ist. Keine*r der schwarzen Studierenden hat der Person zufolge, die mir diesen Vorfall berichtet hat, auch nur mit der Wimper gezuckt; eine demütigende öffentliche Entschuldigung wurde von einer Gruppe weißer Studierender eingefordert.
Das Muster, das diesem Vorfall zu Grunde liegt, wiederholt sich in vielen der Zuschriften: Weiße Studierende sind »woker« als ihre schwarzen Kommiliton*innen. Darin zeigt sich sehr deutlich, dass es den Anhänger*innen dieser neuen Glaubenslehre um die demonstrative Zurschaustellung der eigenen moralischen Unfehlbarkeit und nicht so sehr um soziale Gerechtigkeit geht. Ein ähnlicher Vorfall: Derselbe Professor gibt die Lektüre eines Buchs auf, in dessen Titel ein Wort vorkommt, mit dem homosexuelle Männer beschimpft werden. Es handelt sich um einen vielschichtigen, zudem ironisch gewählten Titel, und in dem Buch geht es um eine Kritik traditioneller Männlichkeitskonzepte. Ein homosexueller Kursteilnehmer störte sich keineswegs daran, das Buch lesen zu müssen, eine Gruppe heterosexueller Frauen dagegen schon; sie meldeten den Professor bei seinen Vorgesetzten.
Es ist alarmierend, wie viele der Zuschriften so klingen, als hätten sie so oder ähnlich auch in der stalinistischen Sowjetunion oder dem maoistischen China geschrieben worden sein können. Ein Professor für Geschichte hat mir berichtet, dass die Leitung der Universität, an der er arbeitet, allen Ernstes in Erwägung zieht, ein System zu installieren, das Studierenden und Lehrenden ermöglichen soll, anonym zu melden, wenn in ihren Augen jemand eine »voreingenommene Haltung« erkennen lässt. Ein*e Professor*in hat die Sünde begangen, eine Vorlesung über einen der amerikanischen Gründerväter gehalten und damit angeblich »die Perspektive weißer Männer privilegiert«, obwohl die historische Persönlichkeit, um die es in diesem Fall ging, von Frederick Douglass, dem ehemaligen Sklaven und späteren Abolitionisten, gepriesen wurde. Die Hochschulleitung wollte den*die Professor*in dazu bewegen, an einem sogenannten »listening circle« teilzunehmen. Die Studierenden hätten dargelegt, warum sie verletzt sind, die Lehrkraft hätte zuhören und schweigen müssen. Mit anderen Worten: Es sollte die amerikanische und moderne Variante dessen stattfinden, was in Zeiten der chinesischen Kulturrevolution als »Kampf- und Kritiksitzung« bezeichnet wurde.
Die Folge: Akademiker*innen sagen nur noch hinter vorgehaltener Hand, was sie denken. Ein Dozent für Creative Writing schreibt:
Die Mehrheit der Dozent*innen und Hochschulmitarbeiter*innen zensieren sich selbst, aus Angst davor, einer »falschen Meinung« wegen gekündigt zu werden. Inzwischen ist es so schlimm, dass sich die meisten noch nicht einmal trauen, Tweets zu liken oder zu retweeten, weil so etwas Disziplinarmaßnahmen nach sich ziehen kann […] Diese Menschen sind davon überzeugt, dass Redefreiheit, wissenschaftliche Überprüfbarkeit und eine gesunde Debattenkultur ihren Wert haben, aber trauen sich nicht mehr, das öffentlich zuzugeben. Man spricht mit Gleichgesinnten darüber, bei ein paar Bier, in der hintersten Ecke einer ruhigen Bar. Überzeugungen dieser Art sind ins Halbdunkel verbannt.
Manch einer wird Äußerungen wie diese als Gejammer verbuchen und finden, dass wir uns nur dann Sorgen machen müssen, wenn Lehrkräfte tatsächlich entlassen werden. Andernorts jedoch wird bereits ein feindseliges Arbeitsumfeld als Grundrechtsverletzung betrachtet, und in einer anderen Zuschrift heißt es:
»Es ist auch nicht nur die Angst, entlassen zu werden, die Lehrende und Studierende zum Schweigen bringt. Es ist auch der Wunsch, Freundschaften zu pflegen, Teil einer Gemeinschaft zu sein, das sind grundlegende psychologische Bedürfnisse. Tatsächlich zeigen Experimente, die die Folgen sozialer Ächtung untersuchen, dass es eine existenzielle Bedrohung darstellt, ignoriert, ausgeschlossen oder abgewiesen zu werden. Wir wissen, wie sich so etwas neurologisch auswirkt. Ostrazismus ist eine Form des sozialen Tods. Damit zu drohen hat Folgen.«
Besonders bedauerlich ist die Tatsache, dass dieser neue Maoismus die Vielseitigkeit des Curriculums beeinträchtigt und den Nachwuchs davon abhält, in die Lehre zu gehen. So unterrichtet ein*e Professor*in James Baldwins Short Story »Going to Meet the Man« nicht mehr, seit Schwarze Studierende angegeben haben, sie müssten durch die Lektüre »transgenerationale Traumata neu durchleiden«. Und gleich zwei Doktorand*innen haben mir geschrieben, dass sie die Universität verlassen hätten. Eine*r schreibt, vergrault habe sie*ihn »ein zunehmend erdrückender Dogmatismus; und potenzielle Arbeitgeber*innen interessierten sich vor allem für Diversitätsbeteuerungen und die Fähigkeit, zum Tendenziös-Ideologischen neigende Kurse zu unterrichten, in denen Philosophie mit Critical Race Theory oder Gender Studies usw. verbunden wird. Ich hatte zunehmend den Eindruck, dass man in diesem Feld nicht wettbewerbsfähig ist, wenn man bei diesen Trends nicht mitmachen will.«
Nur ein Bruchteil der Menschen, die mir geschrieben haben, sind Konservative. Eine politische Verortung links der Mitte zieht sich wie ein roter Faden durch die Zuschriften. Die Menschen fragen sich, warum man plötzlich wie ein reaktionärer Häretiker behandelt wird, sobald man andere als radikale Überzeugungen hegt. Das Problem ist also nicht mehr nur der uralte Kampf zwischen Links und Rechts, sondern das, was ein*e Autor*in als das »Hauen und Stechen« der Linken bezeichnet. Die Frage lautet nicht mehr: »Wieso bist du nicht links?«, sondern: »Wie kannst du es wagen, nicht so links zu sein wie wir?«
Die Umfrageergebnisse der Heterodox Academy und die Berichte, die man mir zugesandt hat, werden in den Augen mancher Leute nichts weiter als »Anekdaten« sein, schließlich handelt es sich in beiden Fällen um Selbstauskünfte, und nur eine wissenschaftliche Langzeitstudie mit 3000 umfangreichen Befragungen, deren Ergebnisse statistisch ausgewertet werden müssten, wäre empirisch überzeugend. Aber machen wir uns nichts vor: Um die moralische Verdorbenheit dieses Landes zu demonstrieren, bräuchte es für viele Menschen kaum mehr als ein halbes Dutzend Berichte über schwarze Studierende, die von ihren Professor*innen strenger benotet werden als ihre weißen Kommilitonen. Diese 150 Zuschriften veranschaulichen auf beredte Art und Weise ein grundlegendes und beunruhigendes Problem.
John McWhorter schreibt regelmäßig für »The Atlantic« und ist Professor für Linguistik an der Columbia University. Er moderiert den populärwissenschaftlichen Linguistik-Podcast »Lexicon Valley«. Kürzlich ist sein Buch »Nine Nasty Words: English in the Gutter Then, Now and Always« (2021) erschienen.
[i]Hochschulinterne »Title IX«-Verfahren sind nach dem gleichnamigen Bundesgesetz benannt und werden nach Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens eingeleitet. Auch anonymen Anschuldigungen wird nachgegangen. Es gibt immer wieder Fälle von Diffamierung.
Aus dem Englischen von Gregor Runge.
Dieser Text mit dem Original-Titel „Academics Are Really, Really Worried About Their Freedom“ erschien am 1. September 2020 in „The Atlantic“.
Gerechtigkeit und offene Debatte – ein offener Brief
Unsere kulturellen Institutionen stehen vor einer Zerreißprobe. Die gewaltigen Proteste für mehr soziale Gerechtigkeit und racial justice, die sich derzeit ereignen, werden begleitet von längst überfälligen Forderungen nach Polizeireformen und mehr Gleichheit sowie Inklusion in allen Bereichen unserer Gesellschaft, nicht zuletzt in den Hochschulen, den Medien und der Welt der Kunst. Diese notwendige zivilgesellschaftliche Abrechnung mit den Verhältnissen in unserem Land hat jedoch auch zur Verschärfung einer moralischen Haltung und eines politisches Handelns geführt, die unsere offene Debattenkultur schwächen. Gegenseitige Toleranz trotz unterschiedlicher Meinungen weichen zunehmend ideologischer Konformität. Während wir gegenseitige Toleranz entschieden begrüßen, lehnen wir ideologische Konformität entschieden ab. Auf der ganzen Welt erstarken die illiberalen Kräfte. Diese haben in Donald Trump, der eine ernstzunehmende Gefahr für unsere Demokratie darstellt, einen mächtigen Verbündeten. Dennoch dürfen wir nicht zulassen, dass sich der politische Widerstand zu einer Form von Dogma verfestigt. Rechte Demagogen ziehen aus der Tatsache, dass dies bereits geschehen ist, längst Profit. Demokratische Inklusion, so wie wir sie uns wünschen, kann nur dann erreicht werden, wenn wir gegen das Klima der Intoleranz, das auf allen Seiten herrscht, unsere Stimme erheben.
Der freie Austausch von Informationen und Meinungen ist das Fundament einer jeden liberalen Gesellschaft und wird mit jedem Tag stärker eingeschränkt. Während wir drastische Formen der Kritik aus dem Lager der radikalen Rechten gewöhnt sind, lässt sich Ähnliches mittlerweile auch weit darüber hinaus beobachten: Intoleranz gegenüber abweichenden Meinungen, öffentliche Demontage und Ächtung und die Tendenz, die Komplexität politischer Fragestellungen vor dem Hintergrund trügerischer moralischer Gewissheiten zu leugnen. Wir glauben nach wie vor an den Wert deutlichen, auch scharfen Widerspruchs, ganz gleich aus welchem politischen Lager. Inzwischen jedoch provozieren vermeintliche Überschreitungen sprachlicher oder gedanklicher Art häufig die Forderung, die betreffende Person müsse bestraft werden. Noch beunruhigender ist die Tatsache, dass die Verantwortlichen in den Institutionen, indem sie panisch versuchen, Schadensbegrenzung zu betreiben, übereilte und unverhältnismäßige Sanktionen verhängen, anstatt wohlüberlegte Reformen anzugehen. Redakteur*innen werden entlassen, weil sie die Veröffentlichung streitbarer Artikel ermöglicht haben; die Publikation von Büchern wird wegen angeblicher »Inauthentizität« zurückgezogen; Journalist*innen dürfen nicht mehr über bestimmte Themen schreiben; Professor*innen, die im Unterricht bestimmte literarische Werke zitieren, müssen mit Untersuchungen rechnen; ein*e Akademiker*in wird entlassen, weil er*sie eine bestimmte Studie in Umlauf gebracht hat, obwohl diese extern begutachtet worden war; Leiter*innen von Institutionen werden ihrer Ämter enthoben, manchmal nur wegen einer Ungeschicklichkeit. Was auch immer die Argumente für die Vorfälle im Einzelnen sein mögen, die Grenzen dessen, was gesagt werden darf, ohne dass Strafmaßnahmen drohen, werden immer enger gezogen. Den Preis dafür zahlen wir bereits. Schriftsteller*innen, Künstler*innen und Journalist*innen scheuen zunehmend das Risiko. Vom Konsens abzuweichen, nicht entschieden genug konform zu gehen, kann existenzgefährdend sein.
In letzter Konsequenz wird dieses Klima den drängenden Vorhaben unserer Zeit schaden. Wenn ein repressives Regime oder eine intolerante Gesellschaft den gesellschaftlichen Diskurs limitiert, schadet das immer denjenigen, die keine Macht haben, schränkt das die demokratischen Partizipationsmöglichkeiten aller Menschen ein. Gegen problematische Überzeugungen können wir nur angehen, indem wir sie demaskieren, indem wir argumentieren und andere Menschen überzeugen – wir dürfen die Menschen, die sie äußern, nicht zum Schweigen bringen oder sie uns davonwünschen. Als Autor*innen müssen wir experimentieren, Risiken eingehen, auch Fehler machen dürfen. Wir müssen weiterhin die Möglichkeit haben, uneins zu sein, ohne ernste berufliche Konsequenzen zu fürchten. Wir können nicht von der Öffentlichkeit oder der Politik erwarten, die Grundlagen unserer Arbeit zu verteidigen, wenn wir nicht selbst dazu bereit sind.
Elliot Ackerman
Saladin Ambar, Rutgers University
Martin Amis
Anne Applebaum
Marie Arana, Autorin
Margaret Atwood
John Banville
Mia Bay, Historikerin
Louis Begley, Schriftsteller
Roger Berkowitz, Bard College
Paul Berman, Autor
Sheri Berman, Barnard College
Reginald Dwayne Betts, Lyriker
Neil Blair, Literaturagent
David W. Blight, Yale University
Jennifer Finney Boylan, Schriftstellerin
David Bromwich
David Brooks, Kolumnist
Ian Buruma, Bard College
Lea Carpenter
Noam Chomsky, MIT (emeritiert)
Nicholas A. Christakis, Yale University
Roger Cohen, Autor
Ambassador Frances D. Cook, Diplomat a. D.
Drucilla Cornell, Initiatorin des uBuntu-Projekts
Kamel Daoud
Meghan Daum, Autorin
Gerald Early, Washington University-St. Louis
Jeffrey Eugenides, Schriftsteller
Dexter Filkins
Federico Finchelstein, The New School
Caitlin Flanagan
Richard T. Ford, Stanford Law School
Kmele Foster
David Frum, Journalist
Francis Fukuyama, Stanford University
Atul Gawande, Harvard University
Todd Gitlin, Columbia University
Kim Ghattas
Malcolm Gladwell
Michelle Goldberg, Kolumnistin
Rebecca Goldstein, Autorin
Anthony Grafton, Princeton University
David Greenberg, Rutgers University
Linda Greenhouse
Rinne B. Groff, Dramatikerin
Sarah Haider, Aktivistin
Jonathan Haidt, NYU-Stern School of Business
Roya Hakakian, Schriftstellerin
Shadi Hamid, Brookings Institution
Jeet Heer, The Nation
Katie Herzog, Podcast-Moderatorin
Susannah Heschel, Dartmouth College
Adam Hochschild, Autor
Arlie Russell Hochschild, Autorin
Eva Hoffman, Autorin
Coleman Hughes, Autor/Manhattan Institute
Hussein Ibish, Arab Gulf States Institute
Michael Ignatieff
Zaid Jilani, Journalist
Bill T. Jones, New York Live Arts
Wendy Kaminer, Autorin
Matthew Karp, Princeton University
Garry Kasparov, Renew Democracy Initiative
Daniel Kehlmann, Schriftsteller
Randall Kennedy
Khaled Khalifa, Schriftsteller
Parag Khanna, Autor
Laura Kipnis, Northwestern University
Frances Kissling, Center for Health, Ethics, Social Policy
Enrique Krauze, Historiker
Anthony Kronman, Yale University
Joy Ladin, Yeshiva University
Nicholas Lemann, Columbia University
Mark Lilla, Columbia University
Susie Linfield, New York University
Damon Linker, Autor
Dahlia Lithwick, Slate
Steven Lukes, New York University
John R. MacArthur, Verleger und Autor
Susan Madrak, Autorin
Phoebe Maltz Bovy, Autorin
Greil Marcus
Wynton Marsalis, Jazz at Lincoln Center
Kati Marton, Autorin
Debra Mashek, Wissenschaftlerin
Deirdre McCloskey, University of Illinois at Chicago
John McWhorter, Columbia University
Uday Mehta, City University of New York
Andrew Moravcsik, Princeton University
Yascha Mounk, Persuasion
Samuel Moyn, Yale University
Meera Nanda, Autorin und Dozentin
Cary Nelson, University of Illinois at Urbana-Champaign
Olivia Nuzzi, New York Magazine
Mark Oppenheimer, Yale University
Dael Orlandersmith, Schriftstellerin/Schauspielerin
George Packer
Nell Irvin Painter, Princeton University (emeritiert)
Greg Pardlo, Rutgers University – Camden
Orlando Patterson, Harvard University
Steven Pinker, Harvard University
Letty Cottin Pogrebin
Katha Pollitt, Schriftstellerin
Claire Bond Potter, The New School
Taufiq Rahim
Zia Haider Rahman, Schriftsteller
Jennifer Ratner-Rosenhagen, University of Wisconsin
Jonathan Rauch, Brookings Institution/The Atlantic
Neil Roberts, Politikwissenschaftler
Melvin Rogers, Brown University
Kat Rosenfield, Autorin
Loretta J. Ross, Smith College
J.K. Rowling
Salman Rushdie, New York University
Karim Sadjadpour, Carnegie Endowment
Daryl Michael Scott, Howard University
Diana Senechal, Dozentin und Autorin
Jennifer Senior, Kolumnistin
Judith Shulevitz, Autorin
Jesse Singal, Journalist
Anne-Marie Slaughter
Andrew Solomon, Autor
Deborah Solomon, Kritikerin und Biografin
Allison Stanger, Middlebury College
Paul Starr, American Prospect/Princeton University
Wendell Steavenson, Autorin
Gloria Steinem, Autorin und Aktivistin
Nadine Strossen, New York Law School
Ronald S. Sullivan Jr., Harvard Law School
Kian Tajbakhsh, Columbia University
Zephyr Teachout, Fordham University
Cynthia Tucker, University of South Alabama
Adaner Usmani, Harvard University
Chloe Valdary
Helen Vendler, Harvard University
Judy B. Walzer
Michael Walzer
Eric K. Washington, Historiker
Caroline Weber, Historikerin
Randi Weingarten, American Federation of Teachers
Bari Weiss
Cornel West
Sean Wilentz, Princeton University
Garry Wills
Thomas Chatterton Williams, Autor
Robert F. Worth, Journalist und Autor
Molly Worthen, University of North Carolina at Chapel Hill
Matthew Yglesias
Emily Yoffe, Journalistin
Cathy Young, Journalistin
Fareed Zakaria
Aus dem Englischen von Gregor Runge.
Dieser Text mit dem Original-Titel „A Letter on Justice and Open Debate“ erschien am 7. Juli 2020 in „Harpers’s Magazine“.
The Making of an Archive – the Legacies of Susan Taubes
Sigrid Weigel
It all began with a novel. Twenty-six years ago, a book by Susan Taubes appeared in German translation under the unfortunate title »Scheiden tut weh« (1995; Eng. »Divorcing«, 1969). Readers were first introduced to her by the fact that she was the first wife of the Jewish religious philosopher Jacob Taubes. That was 26 years after the author’s death, 26 years after the book’s initial publication in the United States. The short timeframe between her first publication and the author’s suicide prompted the German publisher to promote the text as an autobiographical novel and as »Susan Taubes‘ final testament«.
Such an interpretation is, however, ironically undermined by the novel itself. Indeed, it is framed from the perspective of a dead woman, the narrator Sophie Blind. After all, »It is a dead woman who narrates.« This sentence appears in the second chapter as the main character explains the book project to her former lover Ivan when commenting on the origins of the novel: »Now that I’m dead, I can finally write my autobiography.« At the same time, this narrative perspective inverts the usual narrative genre of a literary autobiography: this autobiography is not based on the author’s legacy, but the author’s death is prerequisite for the novel.
Contemporaneity – Susan Taubes and Ingeborg Bachmann
It is not only this aspect of the novel that suggests parallels to Ingeborg Bachmann’s »Malina« (1971). With the disappearance of the first person and the final sentence: »It was murder«, this novel, published two years later, also reflects the origin of the autobiography from the death of the narrating individual. For all the thematic similarities, however, there are clear differences. Taubes‘ writing, for example, is characterized by radical changes between everyday life and dreamlike surroundings. She tells the story of a Jewish intellectual whose memories of a childhood in Budapest in the 1930s are only recounted in the last of the three large chapters – only after one has already learned of Sophie Blind’s accidental death, heard details of her funeral, witnessed a conversation between the surviving husband, scholar and rabbi Ezra, and his student at her deathbed, and only after a series of fantastic scenarios that could have come from a surrealist play are presented to the reader. Indeed, significant distortions occur to the settings, such as the transformation of a wedding into a funeral or the transition of a scientific assembly into the scene of an interrogation and trial. Not only are the plot and linguistic registries interwoven with various modern rituals, but the different places Sophie has been (mainly Paris, Manhattan, Budapest, Jerusalem) and the various people from her life are also crossfaded and merged into each other. This process is also what happens in the dream sequence, which opens up another similarity to Bachmann’s »Malina«, even if the setting of the dream is presented in a separate chapter, divorcing the dream sequence from reality.
Susan Taubes‘ book is also a great, fascinating novel, which made it all the more puzzling that the author was nearly completely unknown, even if the novel does state, among other things, that »everything about me is public.« This phrase, however, is not a reference to the author as an individual but to the suppositions associated with her last name, which stretch both before and beyond the novel. Through her marriage to the contentious religious philosopher Jacob Taubes, her name was by no means a blank slate, and her private life was not entirely unknown within interested circles. The following can, however, be gleaned from the publication of the novel and the contextual information: Born in Budapest in 1928, Susan Taubes had emigrated to the United States in 1939 with her father, a psychoanalyst, and had married Jacob Taubes, a philosopher and rabbi from Vienna who was five years her senior and had grown up in Zurich, with whom she had two children and from whom she had divorced long before her death. If one does not want to read the novel simply as a roman-à-clef, however, not much is known about the writer Susan Taubes beyond her role as the divorced wife of the well-known philosopher.
In this context, it is worth following the hints the author left on the pages of her novel: not the references to her life story, but the clues to her forgotten publications and packed away notes. Whereas in Bachmann’s »Malina«, the first-person narrator, a writer, attempts to hide her love letters in her secretary before her disappearance at the end of the novel in order to keep these legacies from the gaze of the surviving narrator, the relationship between hidden and public writings seems to be the opposite for Susan Taubes‘ main character. Noticeably, her publications were hidden, while her personality was already exposed to the public.
My research, following the path laid out by the novelist, led to the discovery of a completely different, unknown Susan Taubes. Under this author’s name, I found a series of highly interesting works by a philosopher of religion with a doctorate from the 1950s: a dissertation on Simone Weil and several contributions to the philosophy of apophatic theology, into which she incorporates the experiences of modernity, war, the Holocaust, and exile. Thus, in her essay »The Absent God« (1955), with reference to Simone Weil, she examines a modern way of thinking in which the figure of the absent God takes shape through negative theology. After reading these works, the author took on increasingly clear contours; the image of a unique intellectual emerged. Not only does her biography provide insights into Jewish emigration between Europe, the USA, and Israel in the twentieth century; her writings also unfold at the intersection of philosophy, literature, and cultural anthropology, thus foreseeing perspectives that became current with the »cultural turn« in the humanities in the 1980s and 1990s. All this was reason enough to search for further evidence.
Searching for Traces – In Search of Legacies
Sigrid Weigel
Although the search for additional publications did not yield many results, the existing texts did spark curiosity. It was now a matter of changing the scope and method: moving away from the library to the question of whether there was a literary estate, i.e. Nachlass, or whether any other legacies existed. A formal Nachlass, as an institution distinct from a random assortment of dispersed and/or private effects, was not to be found for Jacob or Susan Taubes in any archive. In this respect, it was clear that Susan Taubes had not been one of those authors who arrange their papers, manuscripts, correspondence, and diaries throughout their lifetime in order to prepare them for posthumous publication or their Nachlass.
In the absence of a Nachlass, the task was to search for any legacies or for heirs or surviving family members. Legacies being the documents that are located, as it were, in front of the archive, or outside of it. In any case, they are found in other places, possibly scattered. Legacies are the heterotopias of the archive: they are found in a single real place that juxtapose several spaces, as outlined by Michel Foucault in the well-known essay »Des espaces autres« (1967). They are either not listed in the catalog of Nachlässe, collections, or libraries, or they are hidden in a Nachlass that operate under a different name, documents incognito, as it were, unarchived – unless they fall into the hands of an interested party. Indeed, before documents can be transformed into monuments, into so-called archive material, they have to be identified, located, and filtered, often in quite unexpected spaces. In this respect, they are only partially accessible through systematic research. Research needs to be thereby shifted to the reconstruction and the retracing of possible pasts and past paths and potential locations of testimonies, to the study of transfer in the subjunctive (Transferkunde im Konjunktiv). In doing so, it navigates the results of many individual, be it accidental or intentional, actions. These include those of directly or indirectly affected persons and institutions such as heirs, family members, friends, pen pals, editors, publishers, institutions, etc., through whose hands or files the testimonies reached their current location – the place where they were found. In this way, the actors decided on the preservation or destruction, collection or dispersion of the information.
In the case of Susan Taubes, it was the copyright notice »by Ethan and Tanaquil T. Taubes« that pointed the way. It turned out that these are the names of the children of Susan and Jacob Taubes, both of whom live in New York. Naturally, I contacted them and inquired as to whether there were any other publications by Susan Taubes. The author’s copies and prints they sent me added detail to the picture of the author, who had not only written a novel and various works on the philosophy of religion, but had also published one or two stories and literary-critical contributions on theatre, e.g., on Jean Genet. From a story by Susan Sontag that was sent to me, it could also be deduced that Susan Taubes belonged to a circle of women writers centred around Susan Sontag in the 1960s. The hint to other unpublished manuscripts made me curious. This initial exchange of letters developed into a steady correspondence, and this correspondence led to a first meeting during Ethan Taubes’ 1999 visit to Berlin.
I do not remember how often we sat together afterwards and talked about Jacob and Susan Taubes. From Ethan Taubes‘ stories about his parents, I could admire the art in which he provided a dual perspective, speaking on the one hand as a son, and on the other as a precise observer of the place both parents had in the Jewish Intellectual History of the 20thcentury. From him, I was also able to learn that he and his sister were in possession of their mother’s few material belongings and that Ethan’s apartment in New York contained several boxes of manuscripts, correspondence, and diary entries. In his description of these legacies, I became convinced that they should not sit gathering dust in closed boxes. Many more meetings took place in Berlin and in Manhattan, until we finally signed a contract in which it was agreed that the heirs would leave me the written legacy of their mother, which I would bring to Berlin in order to sift through and potentially compile it into an edited volume.
During the discussions, a number of decisions were made that were prerequisites for the establishment of the Nachlass. The most difficult question for them was whether to give their mother’s legacies to Germany. The heirs ultimately decided to part with the physical documents. I myself had to decide in favour of a longer-term commitment to this legacy, knowing the lengthy path to building up an archive and preparing an edited volume. Briefly summarized, this involved the following steps:
– to transform the legacies into a Nachlass, i.e. to establish the legal form of an archive into whose possession the writings have come (Susan Taubes Archiv e.V.);
– to transfer, arrange, archive, and sift through the papers in order to get an overview and to decide what should be published;
– to raise third-party funds in order to allow for the work at all.
All of this is immensely time-consuming and impossible to manage alone. It was a stroke of luck that I was soon able to win over the literary scholar Christina Pareigis for the project; she is to be thanked above all for the systematic organization of the materials. However, neither of us had any idea at the time how long we would spend working with Susan Tauber’s Nachlass. After an initial review, it became clear that we were dealing with the writings of a very unique author and intellectual. Based on the fascinating evidence ranging from the substantial correspondence between Jacob Taubes in Jerusalem and Susan Taubes in the U.S. and Paris, respectively, in the early 1950s, to literary and scientific manuscripts, to diaries, it was clear that Susan Taubes deserved both a biography and an edited tome.
From Legacy to Archive
Transferring legacies to an archive does not only mean that the writings change hands, become subject to legal forms, and advance to the state of a research object. It also means a change of place and, more importantly, a change from an intimate family space to an institutionalized academic space. In such a transfer, materials are removed from the context of familial memorial culture and placed instead into a research context. Just as the family photo album in the museum becomes a contemporary historical document, love letters in the Nachlass archive are transformed into biographical testimonies. Christina Pareigis and I were exposed to an impressive scene of private memory culture when we flew to New York in the spring of 2003 to transport Susan Taube’s legacies to Berlin. In one of those typical New York apartments in an old building on the Lower East Side, waiting for the handover at the appointed time, we were presented with a scene worthy of a film: On the small dining table, two suitcases with open lids, containing a wide variety of papers – passports from various phases of life, from Hungary and the U.S. with visas for Israel, France, and other places; letters, diary pages, and other scraps of records. Below, under the table, a cardboard box filled with notebooks and envelopes full of manuscripts and correspondence. On the outside of the box, the inscription simply stated: »Mom’s Writings«.
At the sight of these suitcases, a wide variety of images of the suitcase as a symbol of emigration and exile flashed before my eyes: the suitcases in Sigmund Freud’s former apartment in Vienna’s Bergstrasse; Else Lasker-Schüler’s suitcase, found only a few years ago in Zurich, in the basement of the Zurich bookstore Olbricht, meeting place and publication site of many Jewish authors during the Third Reich, a find I had been committed to transferring to the Jerusalem estate at the time; all the way to those suitcase depictions that have become ciphers of emigration in contemporary art. Deciphering the inscription »Mom’s Writings« was synonymous with the realization that a Nachlass not only preserves the legacies of writers, but at the same time destroys their familial afterlife (Nachleben). In this case, afterlife does not mean preservation, but rather the possibility of re-memory. Afterlife – at least in the sense as it was conceived by the first cultural studies around 1900, by Warburg, Freud, and Benjamin – means virtual recurrence. To be sure, there is also another afterlife; it is the afterlife of works through reading, as was extensively discussed by Walter Benjamin. But it was clear at that moment that it would take years for the writings left behind in the archive to be processed – sifted through, selected, transcribed, printed, and published – until they were ready to be read again in a different, public context. First of all, a work must first be produced from the manuscripts in order to enable its afterlife through the act reading.
The scene of the handover was a threshold moment – no longer intimate memory, not yet ordered in the archive: disorganized and organized at the same time. In the physical scene of the New York handover, it looked as follows: Each of the participants picked up a document, began to read quietly, involuntarily reading aloud at particularly fascinating passages. Individual sentences suddenly filled the room, fragments of a biography that at that moment were transformed into a memorial. Later, in the archives, one will search for them again to place them in their »historical context«. A sentence from Susan Taubes‘ never-sent letter to Jacob, about participating in religious rituals, has since become for me a kind of pathos formula of their intimate correspondence: »I’m simply terrified«. A lucky find that will shape editorial and biographical work, beyond all theoretical and methodological reflection. This sentence immediately connected with a statement from Hannah Arendt’s »Denktagebuch«, in which she outlines a little theory on love: »Love is an event that can become a story or a fate.« I’m afraid that in Susan Taubes‘ case, love was clearly fate, if not destiny.
But the question of whether biographical research must not deny itself such associations if, in Philippe Leujeune’s words, it follows the claim to bring information »about a ‚reality‘ that lies outside the text and thus submits itself to the test of truth«. What would this reality be in light of the fact that there are only texts? And why actually »only«?
The Myth of The Eyewitness
Other sources that go beyond texts, which biographers like to consult abundantly, are the so-called eyewitnesses, i.e. contemporaries, friends, partners, colleagues of the person whose life story is being discussed. I confess that I do not think too highly of this kind of testimony. The word »eyewitness« is itself already problematic, as if someone could be a witness of a time, an epoch, or a historical situation; he or she is at best a witness of his or her own specific perspective of experience and perception. Thus, the statements of so-called eyewitnesses or contemporary accounts in the context of biographical research usually communicate more about the observer than about the person about whose personality, habitus, opinion, or development they are supposed to provide information. They often say much more about hidden fears, desires, about competition and jealousy, which are linked to their personal memories of the individual. That is why, in working on the intellectual biography of Ingeborg Bachmann, I had decided to dispense with this kind of information altogether. In the book, contemporary witnesses are replaced by testimonies, be they published or unpublished texts by critics, contemporaries, or friends, which can be read, i.e., scrutinized for the metaphors, slips of the tongue, and presuppositions inscribed in them.
Given the lack of knowledge about Susan Taubes’s circumstances, however, I did not want to forego entirely this time the attempt to interview people who were close to her – so I traveled to New York in the spring of 2004. Through the interviews I conducted there, I was able to gain insights into the lives of New York intellectuals that I am glad I did not miss out on. But I did not learn anything about the author Susan Taubes.
There was the breathtaking view from that Art Deco house on Central Park West, whose façade I had often admired from the park, and where I now sat, in the apartment of a psychoanalyst, to talk with Susan Taubes‘ younger friend about the author. The friend was far too sensitive to the pitfalls of memory, too unforthcoming to judge others, and all too aware that she, as a much younger person, had only partially noticed or even understood anything of the older friend’s life at the time to be able to give any biographical information at all about her deceased friend. There had been little talk about her work anyway. In this respect, the »interview« turned out to be more of a cautious approach to the attempts to understand at least something of the life and especially of the death of Susan Taubes, as we discussed impressions from reading and her memories. None of this would enter into the »biographical context« of Taubes‘ writings.
And then there was the meeting with Susan Sontag, brought about after complicated preliminary talks orchestrated by Tania Taubes, for whom the mother’s friend represented a not unimportant link to the dead. She requested that I thoroughly prepare a few days before: I would need know all of Susan Sontag’s publications, that was important. Yes, of course, her essays on photography and her books on cancer and the illness as a metaphor were very familiar to me. No, the literary texts: Susan Sontag sees herself first as a literary author and also makes a point of being addressed as such. So, I went to the Columbia University Bookstore and got all the Sontag novels and stories I could find and spent the whole weekend with that stack of books. As it quickly turned out, I still was not adequately prepared. For in none of the author’s notes on Susan Sontag did I find that she, too – and before Susan Taubes, as she pointed out – had taught in Columbia’s Department of the History of Religion. In the subsequent conversation, I did not learn much about Susan Taubes, but quite a bit about Susan Sontag. Despite everything, it was an impressive visit, not least because of the view of the surrounding skyscrapers from the penthouse on 24th Street in Chelsea. A few hours before our meeting, Susan Sontag had received news about her cancer, which had returned, and from which she died a shortly thereafter. She nevertheless insisted that we not leave, was at first unfocused, and then spoke about her own personal history. As a parting gift, she handed me a typewritten copy of Susan Taubes‘ dissertation »The Absent God: A Study on Simone Weil: On the Religious Use of Tyranny« (1956), which she had found in her library and of which we in the Berlin archive had previously only had a photocopy. It is the only trace of this encounter that will go into the Nachlass.
This experience and my other New York encounters confirmed my previous conviction: Eyewitnesses are not witnesses to the lives and personalities of others, but only to their own memories. In this respect, they are of little value as references for biographical research. Unsuitable as witnesses for the biographies of others, they are for the most part no longer ascertainable for their own biographies, because these are predominantly created after their death. What remains are the legacies.
Letters and Secrecy of Letters
Letters are – next to the individual’s work – among the most important testimonies of authors. Contrary to Dilthey’s opinion, letters are not of limited value, but they are certainly precarious testimonies, since they establish the dispersion of legacies. In this respect, the testimonies for biographies in the age of epistolary communication that is coming to an end are often hidden in the Nachlass of their pen pals – or have disappeared in their wastepaper baskets. But they are also precarious testimonies because they occupy the threshold to the archive, where personal testimonies and intimate communications are transformed into public documents, where the secrecy of the letter is lifted and the readers – objectively – become confidants or voyeurs. Often letters are on this side of the Nachlass to which they belonged by the author’s name, sometimes not even in the Nachlass of the recipient, especially when such a Nachlass does not exist at all because the recipient is either still alive or was not an »author« or »personality«. Many letters remain potential documents in the status of perpetual latency. Thus, in the case of my book on Bachmann, the simple consideration that her own letters are not in her (partially blocked) Viennese Nachlass, but in the Nachlässe of her presumed pen pals, enabled me to follow a previously unused research path and to open up a completely new field of biographical testimony.
Due to such contexts, letters condense that double meaning from mal d’archive (1995) that Jacques Derrida discussed in his book of the same name: Archive Evil and Desire for the Archive at the same time. The closeness he establishes between archival theory and psychoanalysis is motivated by the disruptions or confusions of the archive associated with the Freudian notion of censorship and the desire for disclosure. »It means having to search ceaselessly, endlessly for the archive, where it pulls itself back. It means running after it, where, even if there is too much of it, something is archived in it.« In the case of a Nachlass, this structure becomes relevant in the most concrete way imaginable: What testimonies end up in a Nachlass? What obstacles stand in the way? Who decides about the corpus, about its accessibility? What kind of desire is directed toward bequests? And in studying letter testimonies that enter an estate, one is confronted in the most concrete way imaginable with the problem of letter secrecy and questions of censorship, across an enormous range of the concept of censorship: from inhibitions about intimate communications – »do I even want to know?« – to legal norms and usages such as the necessary consent of the letter partners and the ban on publication (for up to 30 years after the death of the writer) and considerations of personality protection vis-à-vis persons mentioned in correspondence, to the balancing of the interests of research, the readers, and the public on the one hand, and justified motives for not publishing something or including it in a biography. The threshold between epistolary secrecy and the archive is a hot and contested topic.
Nevertheless, we decided to begin the edition of Susan Taubes‘ writings with the correspondence between Susan and Jacob Taubes from the beginnings of their relationship (1950-1952). It is a quite extraordinary testimony, particularly vivid in its multilingualism: an exchange in which love and philosophy, the struggle for a Jewish life after the rupture of civilization and with the cracks in tradition are inextricably intertwined.
Ins Englische übersetzt von Andrew Stonehouse.
Dieser Text mit dem Original-Titel „Von der Herstellung eines Archivs – die Hinterlassenschaften Susan Taubes“ ist in „Spiegel und Maske. Konstruktion biographischer Wahrheit“ im Jahr 2006 erschienen.
Literatur von und über S. Taubes:
Susan Taubes, Schriften, hgg. v. Sigrid Weigel, München: Fink
Bd. 1,1: Die Korrespondenz mit Jacob Taubes 1950-1951, hgg. u. kommentiert v. Christina Pareigis (2011)
Bd. 1,2: Die Korrespondenz mit Jacob Taubes 1952, hgg. u. kommentiert v. Christina Pareigis (2013)
Bd. 2: Philosophische Schriften, hgg. u. kommentiert v. Thomas Macho und Johannes Steizinger (im Druck)
Bd. 3: Prosaschriften. Hgg. u. kommentiert v. Christina Pareigis. Aus dem Amerikanischen von Werner Richter (2015)
Susan Taubes, Nach Amerika und zurück im Sarg. Roman, übersetzt v. Nadine Miller, Berlin: Matthes & Seitz 2021
Christina Pareigis, Susan Taubes. Eine intellektuelle Biographie, Göttingen: Wallstein 2020.
Sigrid Weigel: Zwischen Religionsphilosophie und Kulturgeschichte. Susan Taubes zur Geburt der Tragödie und zur negativen Theologie der Moderne, In: Literatur als Voraussetzung der Kulturgeschichte. Schauplätze von Shakespeare bis Benjamin. München 2004. S. 127-145.

»SO TO SPEAK«-TRANSKRIPT: JOHN McWORTHER ZUFOLGE MACHEN SICH WISSENSCHAFTLER*INNEN GROSSE SORGEN
Von Nico Perrino
29. Januar 2021
Nico Perrino: Willkommen bei »So to Speak«, dem Free Speech-Podcast. Alle zwei Wochen beschäftigen wir uns anhand persönlicher Geschichten und authentischer Gespräche gänzlich unzensiert mit dem Thema Redefreiheit. Ich bin Nico Perino, der Moderator dieses Podcasts, und mein heutiger Gast ist John McWorther. John ist Associate Professor für Englisch und Komparatistik an der Columbia University. Er ist der Autor von mehr als zwölf Büchern, einer der wichtigsten Linguisten hierzulande und Host des Podcasts »Lexicon Valley«. Letztes Jahr hat John in »The Atlantic« einen viel besprochenen Artikel publiziert: »Akademiker*innen sind um ihre Freiheit besorgt«. Ende letzten Jahres wurde er Leitungsmitglied von »FIRE«, der Foundation for Individual Rights in Education, einer Stiftung, die sich für den Schutz der Persönlichkeitsrechte an Bildungseinrichtungen engagiert. Herzlich willkommen, John. Schön, dass du da bist.
John McWorther: Danke für die Einladung, Nico.
Nico: Okay, lass uns einen Blick in die Vergangenheit werfen: Letztes Jahr im Juli hast du in »The Atlantic« besagten Artikel veröffentlicht. Du berichtest darin von Zuschriften, die dich so gut wie täglich erreichen, Zuschriften von Lehrenden an Universitäten, die Angst um ihre Karriere haben, weil ihre Ansichten nicht mit dem kompatible sind, was du als »Gebote der woken Community« bezeichnest. Was war da los?
John: Mich hat ziemlich überrascht, wie schnell sich das Thema in den Vordergrund gedrängt hat. Letztes Frühjahr, nach dem Mord an George Floyd, kamen viele Menschen zu der Überzeugung, dass mit Amerikas Verhältnis zu race »abgerechnet« werden muss. Diejenigen, die das Ganze vorangetrieben haben, sind von der sogenannten Critical Race Theory beeinflusst. Tatsächlich handelt es sich dabei um eine extreme Form des »Wokeismus«, der sich seit etwa 2014, massiv durch die sozialen Medien befeuert, intellektuelle Kreise durchdrungen hat.
Wer das Land durch die Brille dieser Theorie sieht, hat diesen Moment der »Abrechnung« als Gelegenheit begriffen, uns nicht nur seine*ihre Sicht aufzuzwingen, darüber, wie die Dinge sind und wie sie eigentlich sein sollen und was wir dafür tun müssen, sondern uns in gewisser Weise auch Angst zu machen. Diese Angst hat auch ihre guten Seiten, es geht schließlich um Fragen sozialer Gleichheit, aber die Angst davor, als »Rassist« bezeichnet zu werden, hat viele Leute in wichtigen Positionen dazu veranlasst, sich der Weltsicht dieser Leute komplett zu unterwerfen. Plötzlich wurde man – selbst wenn man dem linken politischen Spektrum zuzuordnen war – für bestimmte Positionen angegriffen oder gekündigt oder von Leuten, die fanden, dass man nicht links genug ist, sich nicht in einem ausreichenden Maß daran beteiligt, die Machtungleichheiten in unserer Gesellschaft abzubauen – und das ist es ja, worum es hier hauptsächlich geht –, plötzlich wurde man von diesen Leuten an den Pranger gestellt.
Ich habe diese Theorie schon immer kritisch gesehen, und über die letzten Jahre bin ich relativ bekannt geworden, weil ich mich an der Debatte über freie Meinungsäußerung beteilige. Ich habe mich daran gestört, dass ein Freund von mir, der Sprachwissenschaftler Steven Pinker, von einer sehr kleinen, aber sehr lautstarken Gruppe von Kolleg*innen angegriffen wurde. Diese Leute fanden, er sei nicht »woke« genug, und forderten, man solle ihm seine Ehrungen und sein Standing innerhalb der Linguistic Society of America aberkennen. All dem lag eine reichlich bemühte Lesart seiner Tweets und Statements zu Grunde.
Ich habe auf Twitter sehr entschieden Partei für ihn ergriffen, entschiedener als ich mich je zuvor auf Twitter geäußert hatte. Und plötzlich sagte eine ganze Reihe von Leuten, dass auch sie den Umgang mit Steve als ungerecht empfunden hätten. Und dann bekamen ich und Glenn Loury, mit dem mich in einer Ausgabe von »Bloggingheads« über die Sache unterhalten hatte, Zuschriften von Lehrenden aus dem ganzen Land und der ganzen Welt, die uns erzählten, dass sich das Klima massiv geändert hat. Obwohl ich im letzten Sommer mit einer Reihe anderer Dinge beschäftigt war, gehörte ich auf einmal zu einer Gruppe von Leuten, die gewissermaßen als Dokumentationsstelle für solche Fälle angesehen werden. Und was mich wirklich beeindruckt hat, war die Vielzahl an Zuschriften.
Nico: Erreichen dich diese Mails nach wie vor? Oder ist es weniger geworden?
John: Ich bekomme mindestens eine Zuschrift pro Woche. Ich sammle nach wie vor alles in einer Datei. Gerade fällt mir noch ein, dass auf Twitter damals jemand behauptet hat – eine*r der Sprachwissenschaftler*innen, die sich an der Aktion gegen Steven Pinker beteiligten hatten, glaube ich –, ich würde lügen und dass ich keine Zuschriften dieser Art bekommen hätte. Also habe ich getwittert: »Ich lüge nicht und kann diese Berichte gern zur Verfügung stellen«. Das wurde dann auch angefragt. Ein paar Wochen gab es eine Flut von Anfragen. Aber ja, wie gesagt, im Moment kommt ungefähr eine Mail pro Woche.
Nico: Viele Leute, die dir schreiben, wollen anonym bleiben, um ihren Job nicht zu gefährden, das ist ein Problem. Würdest du sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen denen, die öffentlich ihre Meinung sagen und denen die anonym bleiben wollen? Geht es hier um die Aussicht auf ordentliche, das heißt unkündbare Professuren? Die Karriere wird wohl eine große Rolle spielen, Leute müssen ihre Hypotheken abzahlen und haben Familien, viele wollen den Kahn wahrscheinlich nicht zu sehr ins Schaukeln bringen. Aber irgendwann erhofft man sich eben doch eine kritische Masse an Betroffenen, die sich öffentlich und entschieden für ein Ende der Zensur aussprechen. Aber bis es so weit ist, wirst du wohl weiter diese Mails bekommen.
John: Meinem Eindruck nach ziehen vor allem ältere Leute, das heißt unkündbare Professor*innen, deren Laufbahn sich dem Ende nähert, in Erwägung, an die Öffentlichkeit zu gehen und/oder nicht anonym zu bleiben. Und ja, das Problem lässt sich nur überwinden, wenn eine kritische Masse couragierter Leuten zusammenkommt. Aber man trifft nicht mal eben so die Entscheidung, in die Öffentlichkeit zu gehen, das hängt ganz von den Umständen ab. Wer allerdings glaubt, dass die Leute, die sich mit dieser Ideologie infiziert haben, ansprechbar sind, dass man sie zum Beispiel über John Stuart Mill aufklären und ihnen begreiflich machen kann, dass Meinungsvielfalt wichtig ist, der irrt. Was das angeht, habe ich keinerlei Hoffnung.
Nur sehr wenige dieser Leute sind ansprechbar und lassen sich überzeugen. Und genau denen müssen wir unsere Position klarmachen. Damit sie damit aufhören zu glauben, sie könnten alles erreichen, indem sie andere beschimpfen. Andererseits habe ich leicht reden, ich bin 55 und Professor und werde meinen Job nicht verlieren, außerdem beziehe ich mein Einkommen nicht nur aus einer Quelle. Aber klar, wenn ich als Dozent an einer Fakultät für Geschichtswissenschaften arbeiten würde, deren Belegschaft mit Ausnahme vielleicht der chinesischen Kollegin am Ende des Flurs dieser woken Ideologie anhängt, und wenn ich damit rechnen müsste, gekündigt zu werden, würde ich erst dann etwas sagen, wenn ich ordentlicher Professor geworden bin und nicht mehr gekündigt werden kann.
Aber selbst dann wird einem unter Umständen gedroht. Übrigens bin ich aus bürokratischen Gründen, die viel zu langweilig sind, um sie hier auszubreiten, kein ordentlicher, unkündbarer Professor. An der UC Berkeley war ich das zwar, nicht aber an der Columbia University, und höchstwahrscheinlich werde ich es dort auch nie werden. Aber ich sage trotzdem meine Meinung, weil ich aus verschiedenen Gründen davon ausgehen kann, dass man mich nicht entlassen wird. Und selbst wenn man mich entlassen würde, käme ich noch über die Runden. Aber das gilt nur für mich. Andere Leute müssen vorsichtiger sein.
Nico: Nicht immer können Lehrende oder Fakultätsangestellte wissen, wo eigentlich Gefahren lauern oder worin diese Gefahren bestehen. Du hast neulich über einen Fall an der University of Illinois in Chicago getwittert. Es ging um einen Jura-Professor, der über Jahre hinweg ein- und dieselbe Fallstudie abgeprüft hat, in der es um Diskriminierung am Arbeitsplatz geht. In der Beschreibung des Sachverhalts, den die Studierenden juristisch kommentieren sollten, kommen zwei Schimpfwörter vor. Im Text waren aber nur die Anfangsbuchstaben zu lesen, die Anzahl der restlichen Buchstaben war durch Unterstriche kenntlich gemacht. Und trotzdem sieht sich dieser Professor mit einer Untersuchung konfrontiert. Man könnte also sagen, dass es Gefahren gibt, mit denen man rechnen kann –Politik, Critical Race Theory, sexuelle oder Genderidentität –, aber ich hätte nicht gedacht, dass es problematisch sein könnte, Jura-Studierende mit Falldarstellung zu konfrontieren, in denen eher unappetitliche Aspekte des menschlichen Wesens zum Ausdruck kommen. Aber für den Professor ist diese Sache zu einem Problem geworden. Wie viele Fälle, von denen du weißt, sind mit diesem vergleichbar? Fälle, in denen Lehrende unabsichtlich auf eine dieser Minen treten?
John: Es werden immer mehr, was ich sehr beunruhigend finde. Der von dir geschilderte Fall ist besonders verstörend, weil die Dinge hier auf der Hand zu liegen scheinen. In all den Jahren zuvor hat sich niemand an der Prüfungsfrage gestoßen. Dass sich das ausgerechnet 2021 geändert hat, nach allem, was im letzten Frühling passiert ist, ist kein Zufall. Fälle wie der in Chicago häufen sich. Jemand tut etwas, ist dabei vollkommen arglos und verliert trotzdem seinen Job, dabei hätte noch vor fünf Minuten kein Mensch wegen so einer Sache mit der Wimper gezuckt. Nehmen wir Laurie Sheck, die bekannte Schriftstellerin, die seit zwanzig Jahren an der New School in New York City unterrichtet. Sie hat einen Kurs über James Baldwin gegeben.
Und in dem Kurs hat sie den Dokumentarfilm über Baldwin angesprochen, »I Am Not Your Negro«. Sie hat klargestellt, dass die Stelle bei Baldwin eigentlich anders heißt. Ich gehe davon aus, dass ich hier – aus naheliegenden Gründen – zitieren darf: Jedenfalls heißt es bei Baldwin: »I’m not your Nigger«. Laurie Black ist nicht schwarz, hat aber Baldwin zitiert und das Wort trotzdem verwendet. Im Anschluss hat sie den Kurs zu einer Diskussion über die Frage ermutigt, warum es bei Baldwin so und der Dokumentarfilms anders heißt. Sie wollte eine problembewusste Diskussion über Schimpfwörter und Rassismus führen. Das ist zwei Jahre her, damals wurden Disziplinarmaßnahmen gegen sie eingeleitet. Und vor kurzem wurde sie – was sich bisher kaum herumgesprochen hat – ohne Angabe von Gründen entlassen. Niemand hat gesagt, dass ihre Entlassung mit dem Vorfall in Zusammenhang steht, aber ich kann es mir kaum anders vorstellen…
Nico: Das wusste ich nicht. Dabei haben wir von FIRE uns damals in den Fall eingeschaltet.
John: Mit Erfolg …
Nico: Richtig. Wir wollten die Sache zusammen mit Laurie richtigstellen. Wir haben sie dabei unterstützt, ihre Geschichte exklusiv an »Inside Higher Ed« zu vermitteln, ein Online-Magazin mit großer Reichweite, und bevor ein Artikel hätte erscheinen könnten, hat die Universität eingelenkt. Aber ich wusste nicht, dass sie kürzlich entlassen wurde. Darüber muss ich mit meinen Kolleg*innen sprechen. Wow.
John: Sie hat mir vor zwei Wochen davon erzählt. Das Seltsame an diesem Fall, auch an anderen Fällen übrigens, ist die Tatsache, dass es weiße Studierende sind, die sich beschweren. Bei Laurie waren es zwei, glaube ich. Das ist oft so. Oft sind die Weißen »woker« als die Schwarzen, für die sie angeblich einstehen. Es ist schwer zu begreifen, aber damit es zu Fälle wie dem mit dem unkenntlich gemachten N-Wort in der juristischen Fallstudie kommen kann, braucht es eine bestimmte Art von »Mut«, und das ich sage das nur sehr ungern über Leute, die in ihrer eigenen Perspektive befangen sind, wie Fische, die nicht wissen, dass sie nass sind. Ohne einen bestimmten Typus Schwarzer Menschen – und ja, diese Leute sind viel jünger als ich – gäbe es diese Fälle nicht.
Eine der Studierenden, die gegen den Jura-Professor vorgegangen sind, hat gesagt, sie habe Herzrasen bekommen, als sie das bis auf den Anfangsbuchstaben unkenntlich gemachte N-Wort gelesen hat. Und soll ich dir etwas sagen? Das hat sie nicht. Oder sie hat sich das Herzrasen eingebildet, weil sie Teil von etwas Größere sein wollte. Man muss doch zu dieser vermutlich hochintelligenten jungen Schwarzen Frau sagen: »Nein, tut uns leid, wir werden wegen ausgedachten und völlig unverhältnismäßigen Empfindlichkeiten nicht unsere Unterrichtsmethoden ändern.« Aber wie soll man das als weißer Anzugträger aus der Hochschulverwaltung sagen, wenn man Angst davor haben muss, wie so etwas in den sozialen Medien ankommt. Aber ja, solche Fälle gibt es.
Schwarze Studierende an einer Business School der University of California haben vor einer Weile behauptet, sie hätten sich dadurch verletzt gefühlt, dass während des Unterrichts von einem Mandarin-Wort die Rede war, »naga«. Das ist wohl ein Wort, das im Zusammenhang mit Hedgegeschäften benutzt wird. Das Wort hat Ähnlichkeit mit dem N-Wort, und das hat sie aufgebracht. Solche Sachen passieren tatsächlich. Ab einem gewissen Punkt muss man zu diesen jungen schwarzen Leuten doch sagen: »Das geht so nicht!« Aber dafür sind Universitäten nicht wirklich gemacht. Und trotzdem, wir müssen wir damit anfangen, Möglichkeitsräume zu öffnen, in denen so etwas gesagt werden darf. Es gibt nämlich Situationen, in denen es respektlos ist, den Studierenden genau das zu geben, wonach sie verlangen. Man muss sie doch wie Erwachsene behandeln!
Außerdem liegen in diesen Fällen die Dinge doch auf der Hand, und diese Schwarzen Studierenden werden das auch verstehen, wenn sie zehn Jahre älter sind. Das berührt eine schwierige Frage: Ist es möglich, in Zeiten wie diesen junge Schwarze Menschen mit der Wahrheit zu konfrontieren? Junge schwarze Menschen, die diesen historischen Moment als Rechtfertigung dafür begreifen, unkonstruktive, sogar unbegründete Dinge zu tun?
Nico: Ich wollte dich das eigentlich erst später fragen, aber vielleicht ziehe ich die Frage einfach vor, wo wir gerade schon dabei sind. Es handelt sich um eine grundsätzliche Frage, die ich dir als Sprachwissenschaftler und Autor des Buchs »Nine Nasty Words«, das demnächst erscheint, stellen möchte. Ich muss ein bisschen ausholen: Je stärker man Wörter zensiert – jedenfalls ist das mein Eindruck – umso mächtiger und gefährlicher werden sie. Der Comedian Lenny Bruce hat in den 60er Jahren in einer seiner Nummern eine ganze Reihe von Flüchen und Schimpfwörtern aufgezählt, um sie – so nannte er das – »unschädlich« zu machen. »Indem man diese Wörter ausspricht, macht man sie unschädlich. Wenn man sie zensiert oder aus der Gesellschaft verbannen will, gewinnen sie an Macht.«
Ich habe den Eindruck, dass unsere Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten zunehmend verroht ist. Flüche und Schimpfwörter sind allgegenwärtig, haben in gewisser Weise aber ihre Macht verloren, mit einer bemerkenswerten Ausnahme natürlich, über die wir gerade gesprochen haben. Wie ist das sprachwissenschaftlich zu bewerten? Meinem Eindruck nach sind heutzutage eher Meinungen verboten. In gewissen Kontexten waren bestimmte Meinungen schon immer verboten. Aber wenn man sich die Entwicklung ansieht, dann fällt auf, dass es immer mehr tabuisierte Meinungen gibt, nicht aber tabuisierte Wörter.
John: Das sehe ich auch so. Man könnte das Ganze noch ein bisschen enger fassen. Als obszön oder verwerflich werden nicht mehr solche Ausdrücke angesehen, die religiös oder körperlich konnotiert sind, sondern bestimmte Beleidigungen. »Damn« oder »hell« zu sagen galt früher als unerhört. Dann galt es als unerhört, »shit« und »fuck« zu sagen. Und heute sind es Wörter, mit denen bestimmte Gruppen von Menschen beleidigt werden, die genau die gleiche Ablehnung hervorrufen und als genauso unerhört angesehen werden. Aber nicht, dass man mich missversteht: Einerseits denke ich zwar, dass wir es mit der Tabuisierung des N-Worts übertreiben.
Andererseits hätte ich ein Problem damit, wenn meine Kinder – die beiden sind sechs und neun – das Wort benutzen, allerdings so wie, sagen wir, Rob und Laura Petrie in der »The Dick Van Dyke Show« aus den frühen 60er Jahren, als ihr Sohn Ritchie »fuck« sagt, was in dem Kontext der Szene nur indirekt deutlich wird, weil man damals im Fernsehen nicht die leiseste direkte Andeutung machen durfte. Das Verbot, bestimmte Meinungen zu haben, manifestiert sich linguistisch darin, dass man bestimmte Beleidigungen nicht mehr aussprechen darf. Für sich allein genommen, ist das eine gute Sache.
Besorgniserregend ist nur – um es stark vereinfacht auszudrücken – die demonstrative Zurschaustellung moralischer Unfehlbarkeit auf der weißen Seite und auf der schwarzen Seite – um es noch einmal stark vereinfacht auszudrücken – das Streben nach Gruppenzugehörigkeit, indem man sich unaufhörlich zum Opfer erklärt. So kommt es, dass wir mit Blick auf das N-Wort viel empfindlicher geworden sind als nötig. Inzwischen haben einen Punkt erreicht, wo weiße Studierende versuchen, ihre Professoren dafür abzustrafen, dass sie das Wort »Negro« benutzen, aus der Vorstellung heraus, es handele sich dabei um eine Beleidigung, obwohl es doch für die meisten von uns um einen etwas seltsamen »Archaismus« handelt. Das alles kennt überhaupt keine Grenzen mehr. In »Nine Nasty Words« kommt allerdings nicht so sehr mein gesellschaftskritisches Ich zum Tragen, sondern mein gutgelauntes Linguisten-Ich.
Und deswegen geht es in dem Buch nicht so sehr um die Dinge, die wir hier gerade besprechen. Aber ja, ich schreibe über das N-Wort und das schwulen Männern vorbehaltene F-Wort und das C-Wort mit den vier Buchstaben – das sind im Wesentlichen die Begriffe, an denen wir gesellschaftlich noch massiv Anstoß nehmen. Kurz und knapp gesagt: Scheiß auf »fuck«. (lacht)
Nico: In den Fällen, die du angesprochen hast, sind die Studierenden die treibende Kraft hinter dem, was Verantwortliche an Colleges und Universitäten an Maßnahmen in die Wege leiten. Aber spiegelt das die Verhältnisse tatsächlich wider? Sind es wirklich vor allem die Studierenden oder ist die Lage komplizierter? Passieren solche Dinge auch innerhalb der Fakultätskollegien? Oder innerhalb der Führungsebene, in den Dekanaten und Rektoraten? Wie lässt sich die Dynamik der Ereignisse beschreiben? Was kann man dagegen tun? An wen sollte man sich wenden?
John: Ja, teilweise gehen solche Vorfälle natürlich auf Studierende zurück. Teilweise sind es aber auch Vertreter gewisser »Lager« innerhalb der Fakultäten, die etwa einen offenen Brief wie den in Princeton hervorbringen, der einem Manifest ähnelt und von vielen Lehrenden und Angestellten unterschrieben wurde. Das war kein offener Brief von Studierenden. Und weil vermutlich die Mehrheit der Leute an den Universitäten Angst davor hat, sich zu positionieren, passieren solche Dinge unwidersprochen. Allerdings hat Conor Friedersdorf in einem Artikel in »The Atlantic« gezeigt, dass viele der Unterzeichner*innen nicht alle in dem offenen Brief angesprochenen Punkte unterstützt haben. Und außerdem bin ich mir sicher, dass sich viele nur deshalb daran beteiligt haben, weil sie schlicht nicht diejenigen sein wollten, die sich nicht daran beteiligt haben.
Wir führen dieses Gespräch allerdings zu einem besonderen Zeitpunkt, denn wir sind pandemiebedingt kaum auf dem Campus. Ich arbeite größtenteils von zu Hause. Ich bin vielleicht einmal pro Woche im Büro und mache die Tür hinter mir zu. Das heißt, ich beteilige mich zurzeit nicht wie sonst am Uni-Leben. Deswegen kann ich die Dynamik zurzeit schwer einschätzen, weil ich nicht oft genug mit Studierenden oder Kolleg*innen spreche. Aber wir sehen ja alle die Nachrichten, und natürlich sind die Proteste, an denen sich die Studierenden beteiligen, eine treibende Kraft hinter alldem. Aber, wie gesagt, es gibt auch Fakultätsmitglieder und andere Hochschulangestellte, die sich den Beschwerden der Studierenden bereitwillig anschließen oder sogar noch weitergehen und behaupten, Hochschulen seien rassistische Institutionen, was natürlich in den allermeisten Fällen nicht der Fall ist, Hochschulen vermutlich gehören zu den am wenigsten rassistischen Institutionen der Menschheit.
Nico: Ich frage mich, ob es sich bei den Studierenden und den Fakultätsmitgliedern, die an solchen Vorfällen beteiligt sind, um eine Minderheit handelt – und ich meine Minderheit hier im numerischen und nicht im demografischen Sinn. Die Soziologie lehrt uns, dass Minderheiten in bestimmten Kontexten einen außerordentlich großen Einfluss haben können. Die meisten Leute beteiligen sich gar nicht an diesen Debatten, sie machen einfach nur mit. Auch Fakultätsmitglieder, in Princeton etwa, machen sich Sorgen um ihre Laufbahn und ihre Familie und ihre Hypotheken. Man schreibt solche Aufrufe also auch, um sich zu schützen. Vor allem auch, weil diese Minderheit – und noch einmal: ich meine Minderheit hier im numerischen und nicht im demografischen Sinn – eine drastische Sprache spricht und unter Umständen Vorwürfe zu erheben bereit ist, die die Betroffenen zu Aussätzigen macht.
Rassismus- oder Sexismusvorwürfe kommen einem sozialen Ausschluss gleich. Also setzt man alles daran, damit es gar nicht erst dazu kommt. Man versucht also, sich zu beweisen, auf dem Feld der Critical Race Theory etwa, und so verselbstständigt sich das Ganze dann. Und es gibt auch Studien, die das bestätigen. Wir haben auch eine dieser Studien durchgeführt, die größte ihrer Art, unter College-Studierenden, es geht darin um Fragen der Rede- und ökonomischen Freiheit. Und es hat sich gezeigt, dass ein kleiner Teil der Studierenden den Großteil der Debatte bestimmt.
John: Das stimmt. Diesen Eindruck hatte ich schon immer, an der Columbia University und auch schon früher in Berkeley. Es handelt sich definitiv um eine zahlenmäßige Minderheit, die durch ihre besonders lautstark artikulierten und durch Critical Race Theory beeinflussten politischen Überzeugungen auffällt. Und weil diese Leute nicht lange fackeln und dich attackieren, haben die meisten Leute vor ihnen eine Heidenangst. Ich habe Seminare erlebt, die entweder nicht in Gang kamen oder völlig verzerrt wurden – durch ein, zwei Studierende, die in den ersten zwei Diskussionen ihre Ansichten zum Besten gegeben haben, und dann haben alle anderen gespurt, manchmal mit Ausnahme eines einzigen Studierenden, meist waren es Männer.
Manche Studierende machen in so einem Umfeld nie den Mund auf. Die meisten achten darauf, nichts zu sagen, was den Ärger dieser ein, zwei Studierenden erregen könnte, und machen stattdessen deutlich, dass sie ihre »Wokeness-Theorie« intus haben. Das heißt, die Diskussionen werden verzerrt und die Grenzen dessen, worüber sprechen kann, werden verschoben. Und dabei wollen wir ja noch nicht einmal über unerhörte Dinge diskutieren. In einem meiner Kurse ist es mir aus genau diesem Grund nicht gelungen, das Gespräch in Gang zu bringen, das war der einzige Kurs, in dem einfach nichts funktionieren wollte. Das war 2014, zu einer Zeit also, als ich nach all den Jahren endlich das Gefühl hatte, den Dreh raus zu haben. Aber es hat nichts funktioniert, nichts aus meiner Trickkiste hat geholfen. Es ist einfach kein Gespräch zustande gekommen.
Einmal musste ich fünfzehn Minuten früher Schluss machen, weil wegen ein oder zwei Leuten nichts ging. Das war ein Kurs, mit dem ich das ganze Jahr zubringen musste. Solche Dinge passieren, keine Frage. Diese Leute glauben, sie könnten die Welt von der Wahrheit überzeugen, dabei üben sie eigentlich eine Art Schreckensherrschaft aus. Aber das sehen sie natürlich anders. Eine wesentlicher Punkt ihrer Weltsicht besteht in der Überzeugung, dass sie diejenigen sind, die diejenigen, die an der Macht sind, mit der Wahrheit konfrontieren. Sie sind die Machtlosen und treten den Mächtigen gegenüber für ihre Sache ein.
Aber sie verstehen nicht, dass sie inzwischen diejenigen sind, die in vielen Kreisen alle Macht auf sich konzentriert haben und dass sie ihre Macht nicht ausüben, indem sie Überzeugungsarbeit leisten, sondern indem sie dafür sorgen, dass sich alle in die Hose machen. Das ist ein großes Problem für die Debatte im Moment.
Nico: Allerdings sind es unter Umständen auch Minderheiten – in diesem Fall meine ich tatsächlich demographische Minderheiten – die sich gegen diesen Trend stellen. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Vorfall am Reed College, in Oregon. Eine Gruppe von Studierenden hat dort ein für alle verpflichtendes Seminar – eine Einführungsseminar in die kanonischen Texten der abendländischen Geistesgeschichte – gewissermaßen »besetzt«, um zu erreichen, dass der Kurs weniger eurozentrisch gestaltet wird. Das sah dann so aus, dass sich die Studierenden mit Schildern in der Hand vor der Lehrkraft aufgereiht haben, bis der »Unterricht« zu Ende war. Monatelang ging das so, über mehrere Semester. Und dann hat sich eine Gruppe vornehmlich asiatischer Studierender zu Wort gemeldet und gesagt, dass sie an der Schule sind, um zu lernen, und dass sie auch lernen wollen und dass dieser Protest ihrem Studium im Weg steht. Der Protest flaute dann allmählich ab, teils wegen dieser Beschwerde, teils aber auch deshalb, weil die Universität klein beigegeben und den Lehrplan für diesen Kurs geändert hat. Aber ja, es gibt Situationen, in denen widersprochen wird, vor allem in Zusammenhängen, in dem es vor dem Hintergrund der Critical Race Theory heißt, bestimmte Leute dürften zu irgendetwas keine Meinung haben, weil sie nicht der richtigen Bevölkerungsgruppe angehören. Du hast einen Artikel geschrieben, in dem du das Phänomen als »neuen Maoismus« bezeichnest.
Welche Parallelen würdest du zum Maoismus ziehen? Wenn wir in der amerikanischen Gesellschaft mit Formen des Autoritarismus konfrontiert sind, dann ziehen wir meist Faschismus- oder Nationalsozialismusvergleiche heran. Was den Maoismus angeht, fehlt das Hintergrundwissen, um zu verstehen, welche Formen der Autorität damit verbunden sein könnten. Worin bestehen deiner Ansicht nach die Ähnlichkeiten?
John: Wenn man an die Kulturrevolution denkt, dann denkt man etwa daran, dass jede Form von Meinungsäußerung massiv kontrolliert wurde. Man brachte Menschen dazu, in der Öffentlichkeit Dinge zu sagen, die ihrer Überzeugung widersprachen, oder man hielt sie eben davon ab, Dinge in der Öffentlichkeit sagten, von denen sie überzeugt waren. Dieses Gefühl, dass einem ständig jemand eine Waffe an die Schläfe hält. Was sich im Zusammenhang mit der Critical Race Theory abspielt, ist damit vergleichbar. Und dann kann man immer wieder diese Artikel lesen, in denen gefragt wird, ob man den Kontakt zu seinem Vater, Onkel oder Kind abbrechen sollte, wenn sie sich nicht am linken Rand verorten und nicht die richtigen »woken« Ansichten haben.
Und ja, natürlich, das ist nur eine Fragestellung. Aber man fühlt sich schon an die Kulturrevolution erinnert, wo die Menschen mit ihren Familien und Freunden brechen sollten, wo man seine Familie und seine Freunde verraten sollten, wenn sie ideologisch nicht auf Parteilinie waren. Ich will keinesfalls sagen, dass Critical Race Theory Menschen tötet. Aber in moralischer Hinsicht sind das Gruppendenken – das unerbittliche, bedrohliche Gruppendenken, um das es hier geht – und die radikalen Vorstellungen davon, was uns zu respektablen Menschen macht, mit dem Maoismus vergleichbar. Und ist es nicht interessant? Hitler, okay. Von Hitler haben wir eine Vorstellung. Wir haben Filme gesehen, in denen Hitler von Schauspielern dargestellt wird. Es ist schon kleines Kunststück, keinen Film gesehen zu haben, in dem Hitler vorkommt. Wir haben eine Vorstellung davon, was da schiefgegangen ist. Aber für die Kulturrevolution fehlt uns ein intuitives Verständnis.
Nico: Mir fällt kein einziger Film ein.
John: Weil es keinen gibt, es gibt keinen. Wenn jemand Mao gespielt hat, dann in einem chinesischen Film, und wir wissen nichts davon. Das heißt, ja, die Referenz ist ein wenig obskur, und die Leute begreifen nicht, wie ähnlich die Verhältnisse sind. Aber als ich letzten Sommer diese ganzen Zuschriften bekam, musste ich mir immer wieder vorstellen, dass bedauernswerte Chinesen ihren Verwandten in Übersee schreiben. Genauso klingen diese Berichte nämlich, nur dass da eben eine Philosophie-Professorin schreibt, die an einer kleinen Universität im Mittleren Westen unterrichtet. Die Angst, die Lügen, es ist widerlich; und es unterscheidet sich noch einmal deutlich von den sogenannten »tenured radicals«, diesen »radikalen Professor*innen«, die in den 80er- und 90er angeblich eine Gefahr dargestellt haben. Deren Präsenz wurden von den Rechtskonservativen zur Krise hochgeputscht damals. In den 2010er Jahren haben sich die Verhältnisse dann allerdings wirklich verschärft.
Nico: Von da spielen sich diese »Kampf- und Kritiksitzungen« ab, wenn man sich etwa –
John: [unverständlich] [00:26:42]
Nico: – an Nicholas Christakis erinnert, 2015 in Yale. Eine Gruppe von Studierenden stand damals um ihn herum und hat ihn angeschrien. Bei Bret Weinstein war es genauso, an der Evergreen State –
John: Kannst du dir vorstellen, dass man solche Situationen sogar herbeizuführen versucht? Ich kenne jemanden an der Boston University. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sie beim Namen genannt werden möchte. Jedenfalls hat diese Person keinen Fehler begangen, im Gegenteil, sie hat sogar alles richtig gemacht, und trotzdem wurde diese Person von Leuten mit ernsten Gesichtern aufgefordert, sich an etwas zu beteiligen, das natürlich nicht als »Kampf- und Kritiksitzung« bezeichnet wurde, aber genau darauf hinausgelaufen wäre. Alarmierend, sehr alarmierend sogar.
Nico: Ich habe von vielen Leuten hinter den Kulissen der Boston University gehört, dass die Kultur dort immer –
John: [unverständlich]
Nico: – konformistischer und bedrückender wird. Das heißt, dort ist irgendetwas im Gange. Ich habe letzten Sommer davon gehört, im Zusammenhang mit der »Cancel Culture«-Debatte. Ich würde übrigens gern wissen, was du jetzt, ein halbes Jahr danach, von dieser Debatte hältst. Bist du noch immer so besorgt wie letzten Sommer? Und was ist Cancel Culture deiner Ansicht nach eigentlich? Die Leute verstehen die verschiedensten Dinge darunter.
John: Die Bedeutung von Cancel Culture, das Konzept als solches, verändert sich vor allem durch die sozialen Medien derart schnell, dass es manchmal schwer ist, Schritt zu halten. Die Ausgangsbedeutung hat ihren Ursprung in der Unterhaltungsindustrie. Man zieht die kulturellen Erzeugnisse einer Person zurück und bestraft sie gewissermaßen mit dem Verschwinden. Bill Cosby ist ein klassisches Beispiel dafür. Oder der Comedian Louis C. K., der für eine Weile untertauchen musste und zum Teil noch immer untergetaucht ist.
Analog würde man wohl davon ausgehen, dass es darum geht, jemanden von seinem Arbeitsplatz oder aus den sozialen Medien zu verdrängen und auf diese Weise zum Verschwinden zu bringen. Letzten Sommer fing die radikale Linke damit an, darauf zu bestehen, dass es nicht darum geht, irgendwen zu »canceln«, sondern einer Person ihren guten Ruf abzuerkennen, sie öffentlich zu demütigen, etwas zu tun, um sie zu bestrafen. Die Idee dahinter ist: »Nein, wir wollen diese Person nicht canceln, aber alle sollen damit einverstanden sein, wenn wir sie in Ketten legen und auspeitschen.« Die meisten dieser Leute sind tatsächlich der Ansicht, dass genau das passieren muss.
Das ist, meiner Ansicht nach, Cancel Culture. Wenn wir einen Vorgang als »Cancelling« bezeichnen, heißt es immer: »Wir wollen doch niemanden canceln.« Wie dem auch sei, eines ist klar, es geht dabei immer darum, dass jemand nicht einfach nur kritisiert werden soll. Kritik ist schön und gut, manchmal fällt Kritik auch schmutzig und feindselig aus, aber das reicht hier nicht. Die betreffende Person soll richtig bestraft werden, das ist die Idee dahinter. Und das ist beunruhigend, und das Beunruhigende daran wird von der Tatsache verschleiert werden, dass der Begriff immer komplexer wird, so wie »racial preferences« oder systematischer Rassismus, wo die einzelnen Begriffe plötzlich etwas anderes bedeuten, wenn man sie miteinander verbindet. Es geht nicht mehr um »cancellation«. Es geht im Wesentlichen darum, jemand öffentlich zu attackieren und zu finden, dass das angemessen ist.
Nico: Und es geht darum, den Betroffenen keine Gelegenheit dafür zu geben, sich zu rehabilitieren.
John: Richtig.
Nico: Wenn ich mir das vorstelle, würde ich fast lieber ins Gefängnis gehen als mir meine Karriere und mein Leben ruinieren zu lassen, ohne die Aussicht auf Wiedergutmachung und Rehabilitierung. Viele der Leute, die gecancelt werden, entschuldigen sich. Und einige dieser Entschuldigungen sind aufrichtig gemeint. Wir wissen aus der Soziologie, dass Entschuldigungen verschärfte Reaktionen hervorrufen können, das Gegenüber wird dann noch wütender. Derjenige, der sich entschuldigt, erscheint dann gewissermaßen als Hexe, die noch mehr Strafe verdient hat. Du hast in der Vergangenheit darüber geschrieben und gesprochen, dass dieser neue Maoismus, den du da zu erkennen glaubst, etwas Religiöses an sich hat. Es handelt sich dabei um eine Form der Religiosität – darüber hast du auch geschrieben, glaube ich – ohne das wichtige Element der Buße, ohne die Möglichkeit der Veränderung, die Möglichkeit, das sprichwörtliche Licht zu sehen, wie es im Englischen heißt, etwas zu erkennen also und sich so zu verändern, zum Besseren. Man kann nicht wollen, dass Menschen in eine solche Religion gemobbt werden. Unsere Gesellschaft wird dadurch nur rabiater.
John: Diejenigen, die daran glauben, würden sagen: »Aber wir wissen doch, was gut und richtig ist, und bis wir die Welt von allem Übel befreit und zu einem glücklichen Ort gemacht haben, müssen eben ein paar hässliche Dinge passieren.« Davon sind diese Leute tatsächlich überzeugt. Es gibt eben verschiedene Formen von Religion, und vielleicht ist es auch in Ordnung, wenn eine Religion keinen Gott hat, außer… Ta-Nehisi Coates ist Gott. Wobei ich mir Coates eher als Jesus vorstelle. Diese Religion hat keinen Gott und kennt keine Vergebung, aber es gibt viele Religionen, denen bestimmte Elemente fehlen. Und ja, das Problem ist, dass es in diesen Fällen nichts bringt, sich zu entschuldigen.
Wenn jemand um Entschuldigung bittet, wird nach Anzeichen dafür gesucht, dass die Entschuldigung geheuchelt oder irgendwie unvollständig ist. Entschuldigungen sind grundsätzlich wirkungslos. Noch einmal zurück zu dem bemitleidenswerten Professor, der von seiner Universität »exkommuniziert« wurde, weil er zwei unkenntlich Wörter in seiner Prüfung benutzt hat, das N-Wort und ein Frauen vorbehaltenes Schimpfwort: Dieser Professor hat sich aufrichtig entschuldigt, aber es hat nichts geändert. Und diese Leute, die glauben, sie hätten »den einzig richtigen Weg« gefunden, so wie die Mormonen und die Frühchristen, finden das angemessen.
Das ist auch einer der Gründe, weswegen ich glaube, dass wir mit den Menschen, die so etwas glauben, koexistieren müssen. Sie werden nicht einfach wieder verschwinden, und sie sind nicht ansprechbar. Sie glauben, sie hätten die Antwort auf alles. Wenn Menschen glauben, sie hätten auf alles eine Antwort, wird es auch solche unter ihnen geben, die finden, dass es, wenn man Gutes erreichen will, dazugehört, andere Menschen zu verletzen, sie mit Füßen zu treten und von ihren Posten zu vertreiben. Das ist unvermeidbar. Das war in der Menschheitsgeschichte immer wieder so. Die Frage ist nur: Wie gehen wir damit um, dass diese Menschen so viel Macht über unsere Gesellschaft haben? Verändern werden sie sich nicht. Was also können wir tun, damit sie nicht weiter den gesellschaftlichen Kurs bestimmen?
Nico: Es ist interessant, dass wir dieses Phänomen zu einem Zeitpunkt beobachten, wo sich ein Trend zu Reformen im Strafrecht abzeichnet. Wer gegen Gesetze verstoßen und gesellschaftliches Unrecht begangen hat, soll weniger hart bestraft werden; und wir reden hier auch über Menschen, die gewalttätig gewesen sind. Im Moment sprechen wir allerdings über Wörter, die, so wird natürlich argumentiert, auch Gewalt darstellen können. Es gibt also einerseits dieses Trend zur Strafrechtsreform, und andererseits scheint es so auszusehen, als würden Vergebung und Wiedergutmachung aus dem öffentlichen Diskurs und dem Bewusstsein der Öffentlichkeit verbannt. Das erscheint mir bemerkenswert.
Ich hätte gern noch etwas mehr Hintergrundinformationen: Haben dich die Themen Redefreiheit und akademische Freiheit schon immer interessiert und/oder hat sich dieses Interesse durch die Erfahrungen, die du in diesem Bereich gemacht hast, entwickelt?
John: Durch die Erfahrungen. Noch vor zehn Jahren wäre ich überrascht gewesen, wenn du mir gesagt hättest, dass ich bald bekannt sein würde als jemand, der sich mit Redefreiheit beschäftigt und gegen Critical Race Theory zu Felde zieht. Von der Theorie hatte ich vor zwanzig Jahren zwar schon gehört, aber das Ganze hat sich dann erst langsam entwickelt. Auch dadurch, dass ich bemerkt habe, wie brillante Studierende quasi verstummen, wegen einer Ideologie, die nicht zur Neugier ermutigt. Und das erschreckt mich. Mit der Zeit habe ich begriffen, dass ich zwar nicht per se besonders interessiert bin an diesen Themen, aber eben doch sehr von ihnen beeinflusst.
Der ein oder andere, der das jetzt hört, denkt vielleicht, dass ich mich mit dem, was ich heute tue, rächen will. An Leuten, die 1997 meine Gefühle verletzt haben oder so. Damals erschien mein erstes Buch, »Towards a New Model of Creole Genesis«. Ich wollte zu Beginn meiner akademischen Laufbahn über Sprache nachdenken und habe das Resultat veröffentlicht. Ich war jung und naiv und mit den Schlagwörtern der Critical Race Theory, die damals bei Weitem nicht so verbreitet war wie heute, noch nicht vertraut. Aber es gab ihre Vertreter bereits. Und weil diese Theorie überproportional viele Anhänger*innen vor allem in den Geisteswissenschaften hat, gab es sie natürlich auch bei den Linguisten.
Und so kam es, dass ich heftig beschimpft wurde, von Leuten, die sich schlicht nicht dafür interessierten, was ich zu den Vorwürfen zu sagen hatte und die das Ganze seltsam aufbauschten. Wenn ich heute zurückblicke, denke ich, das waren »die Auserwählten«. In meinem aktuellen Buch, das demnächst erscheint, nenne ich die Anhänger der Critical Race Theory »die Auserwählten«. Es gab sie also damals schon. Sie sind der Grund dafür, dass ich nicht sagen soll, dass schwarze Kinder aus sozioökonomischen Gründen Schwierigkeiten in der Schule haben und nicht deshalb, weil Black English vom Standard abweicht. Ihretwegen darf ich nicht sagen, dass dieses Problem nicht linguistisch begründet ist. Stattdessen wird von mir erwartet, dass ich gegen die Machtungleichheit zwischen Schwarz und Weiß ankämpfe und aus diesem Grund alles auf race zurückführe.
Heute würde ich mich nicht mehr wundern. Aber damals dachte ich: »Wieso darf ich das nicht sagen? Ich setzte mich doch auch für soziale Gerechtigkeit ein.« Ich durfte bestimmte Dinge über Kreolsprachen nicht mehr sagen, das jamaikanische oder das haitianische Patois etwa. Oder Papiamento. Zum Beispiel durfte ich nicht sagen: »Diese Sprachen sind entstanden, weil die Sklaven die europäischen Sprachen nicht von Grund auf gelernt hatten und das Wissen, über das sie verfügten, zu einer völlig neuen Sprache verbanden. Toll, oder?« Das durfte ich deshalb nicht sagen, weil das bedeutet hätte, dass die Sklaven die Sprache nicht richtig konnten und dass sie deswegen eine Sprache hervorbrachten, die keine »richtige« Sprache war.
Kein Scherz, ich übertreibe nicht. Ich durfte nicht sagen, dass Kreolsprachen was Tolles sind und dass es sich um neue Sprachen handelt. Und wenn ich doch so etwas sagte, schleuderte man mir Foucault entgegen und warf mir »reverse racism« vor. Heute wüsste ich, worauf ich mich einlasse. Ich würde mich darauf vorbereiten und trotzdem sagen, was ich denke. Damals, 1999, fühlte ich mich aber angegriffen. Und heute sehe ich eben nicht nur Studierende und Lehrende, die einen Maulkorb tragen, sondern begreife auch: »Hm, das kam mir ja schon damals in die Quere, als ich noch keine 30 Jahre alt war.« Und ich weiß ganz sicher, dass die aktuellen Verhältnisse die Forschungsarbeit in vielen Bereichen einschränken, auch in Bereichen, in denen ich aktiv bin, und ich finde, das muss ein Ende haben.
Die Critical Race Theory und ihre Vertreter*innen müssen mit an den Tisch. Ich will auch nicht sagen, dass diese Theorie nur übergeschnappt ist. So jedenfalls habe ich sie anfangs nicht wahrgenommen. Meiner Wahrnehmung wollte diese Theorie einen soziopolitisch- exzentrischen, aber interessanten Blick auf unsere Gesellschaft werfen. Aber dass die Theoriegläubigen am Ruder stehen und allen anderen den Mund verbieten? Nein, das ergibt keinen Sinn, weder intellektuell noch moralisch.
Nico: Würdest du sagen, dass es an ideologischer/politischer Diversität mangelt, was die linguistische Community angeht? Oder handelt es sich hier um eine kleine Minderheit, die das Ganze antreibt, wie vorhin schon kurz angesprochen? Mir fällt gerade der Soziologie Jonathan Haidt ein. Haidt war vor vielen Jahren auf einer Konferenz und hatte dort eine Art Aha-Erlebnis, als er während eines Vortrags hunderten von Soziolog*innen eine Frage stellte: ob sie von Kolleg*innen wüssten, die dem politisch konservativen Lager zuzurechnen sind. Eine Handvoll Leute hat sich gemeldet. Und das ist vielleicht ein Teil des Problems. Aber womit hat das zu tun? Mit der Einstellungspraxis vielleicht? Oder damit, wie Menschen sich in Gruppen zusammenfinden? Jedenfalls scheint es innerhalb der Institutionen kaum politischen Dissens zu geben. Aber dieser Dissens ist laut Haidt an Universitäten sehr wichtig. Weil es so einen Wettstreit um politische Ideologien geben kann.
John: Das stimmt.
Nico: Cass Sunstein hat viel darüber gearbeitet, bei ihm geht es vor allem um die Besetzungen von Richtern. In dem Sinne als ideologisch uniforme Richter-Panel zu härteren Urteilssprüchen neigen. Im Unterschied zu Panels beispielsweise, in denen auch nur ein*e einzige*r Richter*in sitzt, die politisch anders ausgerichtet ist.
John: Die Linguistik ist in der akademischen Welt ein gutes Beispiel dafür. Dazu kommt, dass sich Linguisten – anders als die meisten Leuten verständlicherweise denken – nicht mit der Geschichte und Definition von Wörtern beschäftigen. Die meisten dokumentieren weit weg von zuhause kleine Sprachen, die nur von einer kleinen Anzahl von Menschen gesprochen werden, bewahren sie manchmal auch vor dem Aussterben. Linguisten sind also in gewisser Weise auch Anthropologen, und das bedeutet, dass sie sich nicht selten für Menschen interessieren, die unter völlig anderen Umständen leben als, sagen wir, eine weiße Person, die der Mittelschicht angehört.
All das für sich genommen ist großartig, aber oft geht diese Art von Engagement – und das scheint mir vor allem für die Anthropologie zuzutreffen – mit einem linken politischen Selbstverständnis und mit genau dieser Form von agonistischer Geisteshaltung einher, über die wir hier sprechen. Also ja, so etwas findet sich auch in der Linguistik. Ich kenne kaum aktive konservative Sprachwissenschaftler*innen mit republikanischem Parteibuch, die unter 50 sind. Ein paar ältere gibt es schon, aber unter 50? Ich müsste lügen, mir fällt keiner ein. Und zurzeit folgt eine junge Generation nach, die besonders entschieden hinter Andersgläubigen her sind. Diese Leute sind eine Minderheit, aber ich weiß aus glaubwürdigen Quellen, dass diese Leute einen unverhältnismäßig großen Einfluss auf ihre Kolleg*innen ausüben. Das heißt, in der Linguistik sieht es so aus wie in den anderen geisteswissenschaftlichen Disziplinen auch.
Nico: Was sagst du eigentlich als Sprachwissenschaftler zu der aktuellen Situation? Was ist darauf zurückzuführen, wie wir miteinander sprechen oder wie bestimmte Wörter verwendet und sanktioniert werden? Mir fällt »The Coddling of the American Mind« ein, ein Buch von Jonathan Haidt, über den wir vorhin gesprochen haben, und meinem Chef Greg Lukianoff. Die beiden haben die Welt bereist, in vielen Ländern Gespräche geführt und in der Folge festgestellt, dass die Rachsucht und Bösartigkeit, die wir hierzulande erleben, den englischsprachigen Ländern vorbehalten war – jedenfalls zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung, 2018.
Gibt es irgendeinen Grund anzunehmen, dass das irgendetwas mit unserer Sprache zu tun hat? Oder ist es einfach nur so, dass sich das Phänomen zunächst in den englischsprachigen Ländern ausgebreitet hat, weil es dort seinen Anfang genommen hat? Oder funktionieren Kulturen möglicherweise unterschiedlich, je nachdem, welche Sprache gesprochen wird?
John: Darauf habe ich keine Antwort, ich wünschte, ich hätte eine. Das wäre großartig. Ich würde aber sagen, dass sich das Phänomen nach dem Erscheinen des von dir erwähnten Buchs – ein brillantes Buch übrigens – auch in nicht-englischsprachige Länder ausgebreitet hat. Ähnliche Dinge wie bei uns spielen sich, wie ich gehört habe, auch in Frankreich, Italien, Deutschland und in irgendeinem der skandinavischen Länder ab. Vielleicht hält es sich noch in gewissen Grenzen, aber immerhin. Und nein, ich denke nicht, dass das Phänomen irgendetwas mit Sprache an sich zu tun hat. Man kann in allen Sprachen niederträchtig sein.
Ich glaube eher, dass wir es hier mit einem bestimmten Aspekt der englischsprachigen Kultur zu tun haben. Das Ganze hat ja nicht erst gestern angefangen, sondern begleitet uns schon seit den 80er, 90er Jahren und geht auf die dekonstruktivistische Analyse literarischer Texte zurück, die dann gewissermaßen entgleist ist und auch in bestimmten juristischen Vorstellungen ihren Niederschlag gefunden hat. Aber wie dem auch sei, es gibt keine Möglichkeit, den Leuten klarzumachen, dass wir anders mit Sprache umgehen müssen, weil die »Auserwählten« schlicht nicht zu erreichen sind. Und nicht alle Linken sind ausnahmslos »Auserwählte«. Nicht alle radikalen Linken gehören ausnahmslos dieser Gruppe an. Es handelt sich eben um eine sehr spezifische Untergruppe von Leuten. Keine Sprache der Welt könnte diese Leute erreichen.
Diesen Leuten nahezulegen, anders mit Sprache umzugehen, würde einfach nicht funktionieren. Diese Leute sind überzeugt davon, dass sie denjenigen, die an den Schaltstellen der Macht sitzen, die Wahrheit entgegenhalten, und dass sie sprechen dürfen wie sie wollen. Aber wir brauchen Meinungen. Das heißt, wir müssen untereinander so sprechen, wie wir es für richtig halten, und darauf achtgeben, dass wir nicht in die Situation kommen, in der wir so tun müssen, als hätten diese Leute die Antwort auf alles gefunden. Also, noch einmal, es geht hier nicht um Sprache an sich. Es geht um Ansichten und Absichten. Und in diesem Sinn sollten wir auch darüber nachdenken.
Nico: Hier meine letzte Frage. Du erinnerst dich bestimmt an den demokratischen Abgeordneten Cleaver, der letzte Woche das Eröffnungsgebet im Kongress gesprochen hat. Er hat sein Gebet mit den Worten »amen and awoman« beschlossen, und danach ging die Debatte los. Die Leute waren wütend, weil hier ein Abgeordneter in ihren Augen dieselbe »Wokeness-Politik« betreibt, die hinter vielen Vorfällen steht, die wir besprochen haben. Auch Verwandte und Freunde von mir waren aufgebracht deswegen. Es war ein bisschen so, als wäre eine neue Variante der »Happy Holidays vs. Merry Christmas«-Debatte losgebrochen. Du hast dann allerdings getwittert, dass dieser Ausdruck in bestimmten amerikanischen Gemeinden eine lange Tradition hat. Also, noch mal, für unsere Zuhörer, die glauben, dass die Welt, in der wir leben, völlig übergeschnappt ist: Die Dinge liegen hier doch ganz anders?
John: Richtig. Das war ein interessanter Fall, wirklich wahr. Aber ja, »amen und awoman« ist ein uralter Witz. Cleaver muss geglaubt haben, dass genug Zuhörer*innen damit vertraut sind und dass es keiner Erklärung bedarf. Das war vielleicht ein bisschen ungeschickt. Ich weiß nicht recht, wieso er davon ausgegangen ist. Fakt ist jedenfalls: Viele schwarze und weiße Amerikaner sind durchaus vertraut damit. Wenn es tatsächlich so gewesen wäre, dass die meisten Leute hierzulande diesen Spruch kennen, dann wäre das eine sehr kluge und sehr freundliche Geste gewesen, um die Frauen im Kongress und die Zuschauerinnen anzuerkennen. Das war ein kleiner Scherz. Cleaver ist jedenfalls kein »Wokester«, nicht dass ich wüsste.
Nico: Ich hoffe, der Witz verfängt, mir gefällt er. Aber wahrscheinlich eher nicht. John, das hat großen Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir machen hier Schluss. Ich hoffe, wir haben bald wieder die Gelegenheit, miteinander zu sprechen.
Unverständlich.
John: Das hoffe ich auch. Unbedingt. Danke für die Einladung.
Nico: Das war John McWhorter, Professor an der Columbia University. Seinen Artikel »Akademiker*innen sind um ihre Freiheit besorgt« kann man auf der Website von »The Atlantic« nachlesen. Ich bin Nico Perrino, Gastgeber und Produzent dieses Podcasts. Aaron Reese hat diese Ausgabe geschnitten. Wenn Sie mehr über »So to Speak« erfahren wollen, folgen Sie uns auf Twitter: twitter.com/freespeechtalk oder liken Sie uns auf Facebook: facebook.com/sotospeakpodcast. Feedback bitte an Sotospeak@thefire.org. Wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, schreiben Sie gern eine Bewertung auf Apple Podcasts, Google Play –oder wo auch immer Sie Podcasts hören. Bewertungen unterstützen uns dabei, neue Zuhörer*innen zu gewinnen. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuhören.
Aus dem Englischen von Gregor Runge.
Dieser Text mit dem Original-Titel „So to Speak podcast transcript: John McWhorter says academics are really, really worried” erschien am 29. Januar 2021 in „The Fire“.

