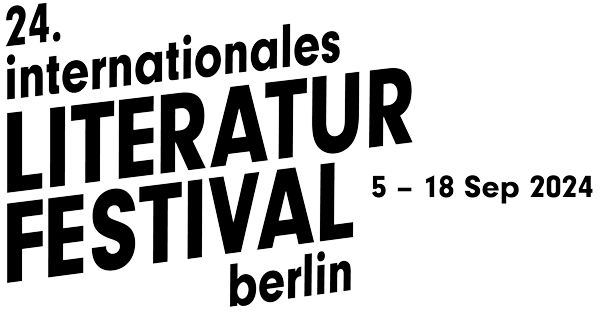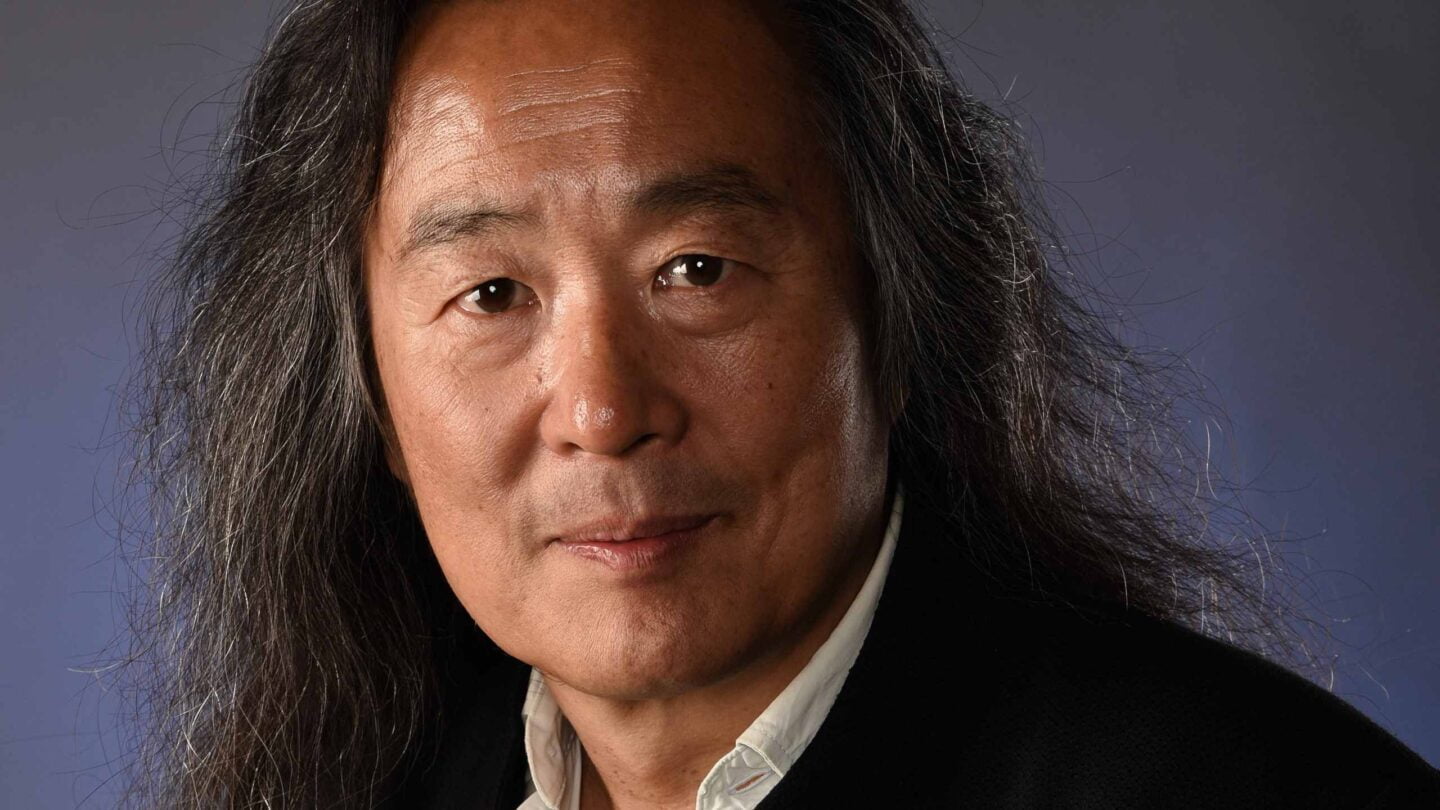
Yang Lian
Als Kind chinesischer Diplomaten wurde Yang Lian 1955 in Bern geboren. Er wuchs in Peking auf und wurde 1974 aufs Land zur »Umerziehung durch Arbeit« geschickt. 1977 begann er als Redakteur und Programmierer für den staatlichen Rundfunk zu arbeiten.
Während des »Pekinger Frühlings« (1978–1980) veröffentlichte er seine ersten »modernistischen« Gedichte in der Untergrund-Literaturzeitschrift »Jintian«. Von 1978 bis 1983 reiste er ausgiebig und suchte nach Spuren der Geschichte seines Landes. Dies fand einen Ausdruck in seinen lyrischen Werken. Unter anderem entstand das Langgedicht »Nuorilang«, das 1983 in einer »Anti-Spiritual Pollution Campaign« scharf kritisiert wurde. Zwischen 1985 und 1989 arbeitete Yang Lian an seinem umfangreichsten Gedichtzyklus »Yi«, der über 200 Seiten umfasst und dessen innere Struktur auf das »Buch der Wandlungen« (»I Ching«, ca. 2800 v. Chr.) anspielt. Nach seiner ersten Reise nach Europa im Jahr 1986 nahm er eine Einladung an, nach Australien und Neuseeland zu reisen. Yang Lian befand sich im Ausland, als er Berichte über das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens im Juni 1989 erhielt. Der Übersetzer Wolfgang Kubin beschreibt die daraus resultierenden Veränderungen in der Arbeit des Dichters: »Das ursprüngliche Pathos … beginnt zu schwinden, die lange Form … wird durch die kurze Form ersetzt, die Bezugnahmen auf China treten in zweierlei Hinsicht zurück: Die chinesische Welt ist nicht mehr das unmittelbare Subjekt seiner Schriften, und Anspielungen auf die chinesische Geistesgeschichte weichen Begegnungen mit westlicher Literatur und Philosophie«. Es bleiben jedoch bekannte Motive, insbesondere die wiederkehrenden Bezugnahmen auf Sterblichkeit und Tod. Mark Renné glaubt, diese könnten auf den frühen Tod seiner Mutter und Yang Lians Erfahrungen als Sargträger zurückzuführen sein. Er verzichtet auf Melancholie und findet stattdessen ständig neue Wege, um zu schockieren, die Leser unerwartet aus der Trance des Alltags zu reißen und sie mit dem Tod und der Verfall des Körpers zu konfrontieren.
Das Exil, das Yang Lians Leben seit über 25 Jahren prägt, hat sich inzwischen zu einer »Weltbürgerschaft« entwickelt (»Frankfurter Rundschau«). Stipendien ermöglichten es ihm, in den 1990er Jahren auf Schloss Solitude bei Stuttgart, 1991 im Rahmen des DAAD-Programms Artists-in-Residence in Berlin sowie 2012/2013 im Wissenschaftskolleg zu arbeiten. Zu den zahlreichen Auszeichnungen für seine Werke gehören der Nonino-Preis (2012), der chinesische Tianduo-Preis für Langgedichte (2013) und der Internationale Capri-Preis (2014). Seit 2005 organisiert Yang Lian als Leiter der Künstlergruppe Unique Mother Tongue Lyrikveranstaltungen in London. Seine jüngste deutsche Veröffentlichung ist die Gedichtsammlung »Erkundung des Bösen« (2023). Lian lebt in London und Berlin.
Li Hun
Dangdai Zhongguo qingnian shiren congshu
Xi’an, 1985
Huang Hun
Shanghai Wenyi Press
Shanghai, 1986
Pilgerfahrt
Hand-Presse
Innsbruck, 1987
[Ü: Angelika Bahrke ]
[Ill: Gan Shaocheng ]
Huang
Ren min wen xue chu ban she
Bei jing, 1989
Ren de Zijue
Sichuan Renmin Press
Sichuan, 1989
In Symmetry with Death
Australian National University Press
Canberra, 1989
[Ü: John Minford]
The dead in exile
Tiananmen
Kingston, 1990
[Ü: Mabel Lee]
Taiyang Yu Ren
Hunan Wenyi Press
Hunan, 1991
Gedichte
Ammann
Zürich, 1993
[Ü: Albrecht Conze und Huang Yi ]
Non-Person Singular
Wellsweep
London, 1994
[Ü: Brian Holton ]
Masken und Krokodile
Aufbau-Verlag
Berlin, 1994
Geisterreden
Ammann
Zürich, 1995
[Ü: Mark Renné ]
China Daily
[mit Alexander Englert]
Schwarzkopf & Schwarzkopf
Berlin, 1995
Der Ruhepunkt des Meeres
Edition Solitude
Stuttgart, 1996
[Ü: Wolfgang Kubin]
Yang Lian Zuo Pin 1982 – 1997
Shanghai Wenyi Press
Shanghai, 1998
Yue Shi De Qi Ge Ban Ye
Unita Books
Taipei, 2001
Notes of a blissful ghost
Chinese University of Hong Kong
Hong Kong, 2002
[Ü: Brian Holton ]
Yi
Green Integer
Los Angeles, 2002
Yang Lian Xin Zuo 1998 –2002
Shanghai Wenyi Press
Shanghai, 2003
Concentric Circles
Bloodaxe
Tarset, 2005
[Ü: Brian Holton und Agnes Hung-Chong Chan]
Unreal City
Auckland University Press
Auckland, 2006
[Ü: Hilary Chung und Jacob Edmond]
Erkundung des Bösen
PalmArtPress
Berlin, 2023
[Rupprecht Mayer, Daniel Bayerstorfer, Lea Schneider u.a.]
Übersetzer: Angelika Bahrke, Hilary Chung, Albrecht Conze, Jacob Edmond, Brian Holton, Agnes Hung-Chong Chan, Wolfgang Kubin, Mabel Lee, John Minford, Mark Renné, Huang Yi