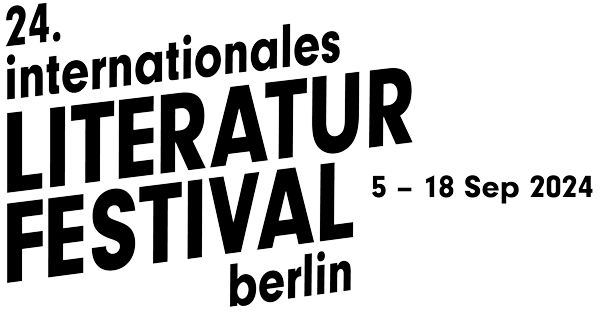Wilhelm Genazino
- Deutschland
- Zu Gast beim ilb: 2001
Wilhelm Genazino wurde 1943 in Mannheim geboren. Nach einem Volontariat bei der Rhein-Neckar-Zeitung in Heidelberg und Mannheim studierte er Germanistik, Philosophie und Soziologie in Frankfurt am Main. Er war als freier Redakteur für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften – unter anderem für das satirische Monatsmagazin »pardon« – tätig, bevor er sich 1971 als freier Schriftsteller in Frankfurt am Main niederließ. Nach seinem wenig beachteten Debüt mit dem Roman »Laslinstraße« (1965) wurde Genazino zunächst als Verfasser von Hörspielen und Sketchen bekannt. Dabei arbeitete er zum Teil mit dem humoristischen Schriftsteller Peter Knorr zusammen, mit dem er 1971 die literarische Schreibagentur »Literatur-Coop« gründete. Seinen Durchbruch als ernsthafter Schriftsteller feierte Genazino mit der Romantrilogie »Abschaffel« (1977), »Die Vernichtung der Sorgen« (1978) und »Falsche Jahre« (1979), auf die bis heute zahlreiche weitere Romane sowie Prosa- und Essaybände gefolgt sind. Von 1980 bis 1986 war Genazino außerdem Herausgeber und Redakteur der Literaturzeitschrift »Lesezeichen«. Er ist Mitglied der Akademie für Sprache und Dichtung, Darmstadt, übernahm 1996 das einjährige symbolische Amt des »Stadtschreibers von Bergen-Enkheim« und erhielt neben weiteren Auszeichnungen 1998 den Großen Literaturpreis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. 2004 wurde er für sein literarisches Schaffen mit dem Georg-Büchner-Preis geehrt. Im Wintersemester 2005/2006 hatte er die Stiftungsgastdozentur Poetik an der Universität Frankfurt am Main inne. Mit seinen sogenannten Angestellten-Romanen der 1970er Jahre stellte sich Genazino zunächst in die Tradition eines kritischen Realismus. Der Entwurf einer »Phänomenologie des Alltags« aus der Sicht eines Angestellten im Großraumbüro formuliert zugleich eine Klage über Entfremdung, Identitätskrise und Wirklichkeitsverlust. Diese Motive bestimmen auch noch die auf die Abschaffel-Trilogie folgenden Romane »Die Ausschweifung« (1981) und »Fremde Kämpfe« (1984). Erst mit »Der Fleck, die Jacke, die Zimmer, der Schmerz« von 1989 verabschiedete sich Genazino zunehmend vom soziologisch-deterministischen Blick und öffnete sich, auch stilistisch, einer individualistischeren Lesart des Alltagslebens. Die Protagonisten seiner heutigen Romane, so formuliert es der Autor selbst, »wissen, wie schwierig es ist, unabhängig zu sein – das heißt auch, unabhängig zu fühlen und zu denken –«, aber sie versuchen es »trotzdem mit einigem Erfolg«. Auf der Suche nach einem adäquaten Ausdruck für seelische Vorgänge, für die Nichtsprachlichkeit, in der wir unseren Alltag wahrnehmen, bietet der Dichter zahlreiche Reflexionen und Betrachtungen von scheinbar unscheinbaren »Ereignissen«, von Begegnungen mit Worten, Dingen und namenlosen Menschen an. In seinem 1998 erschienenen Roman, »Die Kassiererinnen«, begibt sich Genazino auf die Spur eines alternden Großstadtflaneurs, der sein Verhältnis zur Welt mit der Analyse »lächerlicher« Situationen und dem Entwurf von Strategien zu ihrer Vermeidung in den Griff zu bekommen versucht. Den engen Zusammenhang von Erzählen und Erinnern führt Genazino in seinem Album »Auf der Kippe« von 2000 vor. Jedem Foto, das hier vorgestellt wird, – der Autor fand sie den eigenen Angaben zufolge »auf Flohmärkten, bei Trödlern und in Mischantiquariaten« – schließt sich eine Betrachtung an, eine mögliche Erinnerung an ein vergessenes Ereignis. Im Erzählen, so die Meinung Genazinos, wird »das Schicksal der Vergessenheit« beendet, und die Bilder erhalten die »Dignität von Dokumenten« zurück. Zuletzt erschienen der Roman „Mittelmäßiges Heimweh“ (2007) sowie „Lieber Gott mach mich blind“ und „Der Hausschrat“ (2006), zwei Theaterstücke in einem Band. Der Autor lebt in Heidelberg.
© internationales literaturfestival berlin
Laslinstraße
Roman
Köln, 1965
Abschaffel
Rowohlt
Reinbek, 1977
Die Vernichtung der Sorgen
Rowohlt
Reinbek, 1978
Falsche Jahre
Rowohlt
Reinbek, 1979
Der Fleck, die Jacke, die Zimmer, der Schmerz
Rowohlt
Reinbek, 1989
Die Liebe zur Einfalt
Rowohlt
Reinbek, 1990
Aus der Ferne: Texte und Postkarten
Rowohlt
Reinbek, 1993
Die Obdachlosigkeit der Fische
Rowohlt
Reinbek, 1994
Das Licht brennt ein Loch in den Tag
Rowohlt
Reinbek, 1996
Achtung Baustelle
Schöffling & Co
Frankfurt/Main, 1998
Die Kassiererinnen
Rowohlt
Reinbek, 1998
Auf der Kippe
Rowohlt
Reinbek, 2000
Ein Regenschirm für diesen Tag
Hanser
München, 2001
Eine Frau, eine Wohnung, ein Roman
Hanser
München, Wien, 2003
Der gedehnte Blick
Hanser
München, Wien, 2004
Die Liebesblödigkeit
Hanser
München, Wien, 2005
Die Belebung der toten Winkel. Frankfurter Poetikvorlesungen
Hanser
München, 2006
Lieber Gott mach mich blind. Der Hausschrat. Zwei Theaterstücke
Hanser
München, 2006
Mittelmäßiges Heimweh
Hanser
München, 2007