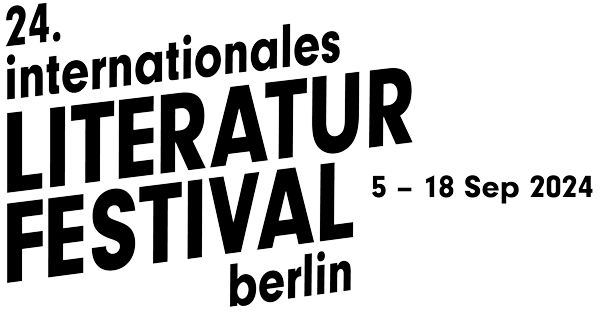Viktorija Tokarjewa
- Russland
- Zu Gast beim ilb: 2003
Viktorija Tokarjewa wurde 1937 in Leningrad geboren. Mit 18 diplomierte sie an der Leningrader Musikhochschule als Pianistin. Nach ihrer Hochzeit mit einem Physiker zog sie nach Moskau um, wo sie drei Jahre als Klavierlehrerin arbeitete. Sie begann früh zu schreiben. Daher immatrikulierte sie sich, um einem Leben als Klavierlehrerin zu entkommen, schließlich an der Moskauer Filmhochschule im Drehbuchfach, die sie 1968 mit einem Diplom abschloss. Kanpp zwanzig ihrer Drehbücher wurden bislang verfilmt. Viktoria Tokarjewa erhielt für ihre Drehbücher zweimal den Ersten Preis beim Internationalen Moskauer Filmfestival sowie 1981 den Ersten Preis beim Internationalen Dokumentarfilmfestival.
1964 – kurz vor dem Rücktritt Chruschtschows und damit dem Ende der Tauwetterperiode – veröffentlichte sie in der Zeitschrift „Molodaja gvardija“ ihre erste Erzählung „Den‘ bez vranja“ (Ü: Ein Tag ohne Lüge), mit der ihr sogleich der Durchbruch gelang. Von der sowjetischen Zensur blieb sie weitgehend verschont, obwohl ihre Erzählungen, die meist um das Thema Liebe kreisen, auf dem Anspruch nach Privatem, Intimem beharren. Schon vor der Perestrojka wurden zahlreiche ihrer Erzählungen publiziert; sie ist in Russland außerordentlich populär und findet auch in Deutschland großen Anklang: Die Mehrzahl ihrer Erzählbände wurden bereits übersetzt, ebenso wie ihr bislang erster Roman „Ptica Scastija“ (dt. „Glücksvogel“, 2005).
Den Schauplatz von Tokarjewas Erzählungen bildet die russische Großstadt. Die Menschen dort, die ihr Leben im Alltäglichen fristen, träumen gelegentlich den Traum von wahrer Liebe, großen Gefühlen und einem sinnerfüllten Leben, haben Angst vor der Einsamkeit oder sie gieren nach Leben. Da gibt es das Mädchen, das den Klavierlehrer liebt, aber nie ein Wort zu sagen wagt („Raraka“), den Starpianisten in der Midlife-Crisis („Ne sotvori“, dt. „Die Diva“) und die männerverschlingende neue Russin, die sich dann doch einmal verliebt („Pervaja popytka“, dt. „Mara“). Meist werden die Figuren am Ende ihrer Illusionen beraubt, gewinnen aber ein kleines Stück Weisheit und manchmal auch so etwas wie Zufriedenheit.
Tokarjewas Erzählungen ist die filmische Ausbildung der Autorin anzumerken: In schlichter, schnörkelloser Sprache werden Bilder aneinandergereiht und mit wenigen Strichen die Szenen skizziert. Die Figuren gewinnen ihren Charakter durch ihre Gesten, durch kleine, alltägliche Handlungen. Wie ihr Vorbild Tschechow beobachtet sie zugleich mit großer Sensibilität und kühler Distanz. Sie schreibt eine „russische Soziologie en miniature“, meist melancholisch, aber stets mit lakonischem Humor.
© internationales literaturfestival berlin
O tom, tschego ne bylo
Molodaja Gvardija
Moskva, 1969
Kogda stalo nemnoschko teplee
Sovetskaja Rossija
Moskva, 1972
Letajuschèie katscheli
Sovetskij Pisatel
Moskva, 1987
Und raus bist du
Ammann Verlag
Zürich, 1987
Übersetzung: Elsbeth Wolffheim
Zickzack der Liebe
Diogenes
Zürich, 1990
Übersetzung: Monika Tantzscher
Mara
Diogenes
Zürich, 1993
Übersetzung: Angelika Schneider
Happy-End
Diogenes
Zürich, 1994
Übersetzung: Angelika Schneider u. a.
Korrida
Vagrius
Moska, 1994
Lebenskünstler und andere Erzählungen
Diogenes
Zürich, 1994
Übersetzung: Ingrid Gloede
Den bes vranja
SP Kvadrat
Moskva, 1995
Die Diva
Diogenes
Zürich, 1995
Übersetzung: Angelika Schneider
Na tscherta nam tschuschie
Lokid
Moskva, 1995
Povesti i rasskazy
Lokid
Moskva, 1995
Sag ich’s oder sag ich’s nicht?
Diogenes
Zürich, 1995
Übersetzung: Angelika Schneider
Schla sobaka po rojalju
Lokid
Moskva, 1995
Loschadi s kryljami
Lokid
Moskva, 1996
Rimskie Kanikuly
Lokid
Moskva, 1996
Sentimentale Reise
Diogenes
Zürich, 1997
Übersetzung: Angelika Schneider
Skaschi mne tschto-nibud
Eksmo
Moskva, 1997
Moschno i nelzja
Eksmo
Moskva, 1998
Der Pianist
Diogenes
Zürich, 2002
Übersetzung: Angelika Schneider
Strelec
AST
Moskva, 2002
Eine Liebe fürs ganze Leben
Diogenes
Zürich, 2003
Übersetzung: Angelika Schneider
Kazino
AST
Moskva, 2003
Pervaja popytka
AST
Moskva, 2003
Lampenfieber
Diogenes
Zürich, 2003
Übersetzung: Angelika Schneider
Rozovye rozy
AST
Moskva, 2003
Gladkoe litschiko
AST
Moskva, 2004
Perelom
AST
Moskva, 2004
Glücksvogel
Diogenes
Zürich, 2005
Übersetzung: Angelika Schneider
Übersetzer: Angelika Schneider, Monika Tantzscher