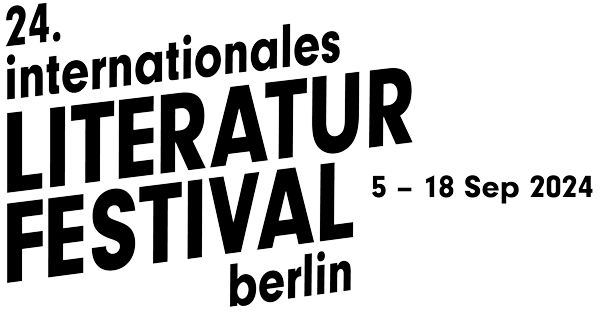Tomaž Šalamun
- Slowenien
- Zu Gast beim ilb: 2003
1941 im jugoslawischen Zagreb geboren, wuchs Tomaz Salamun im slowenischen Koper als Sohn eines Kinderarztes und einer Bibliothekarin auf: eine offenbar behütete Kindheit mit drei Geschwistern an der Schnittstelle dreier Kulturen – Mitteleuropa, Mittelmeer und Balkan. Während seines Studiums der Geschichte und Kunstgeschichte an der Universität von Ljubljana war er an der Literaturzeitschrift „Perspektive“ beteiligt, in der seine ersten Gedichte erschienen. 1964 kam sein erster Gedichtband heraus, eine Attacke gegen die kommunistische Bürokratie. Ab 1965 war Salamun Assistent für Kunstgeschichte an der Universität, 1968-69 Kurator an der Moderna Galerija in Ljubljana. Als Konzept- und Environment-Künstler wurde er mit seiner Gruppe OHO zu einer Ausstellung im MOMA nach New York eingeladen, was ihm eine weitere Kultur eröffnete. 1971-73 nahm er am International Writing Program in Iowa teil, wo er auch beim Übersetzen von W. C. Williams und Wallace Stevens die Frische und Andersartigkeit der amerikanischen Lyrik kennen lernte. 1986 brachte ihn ein Fulbright-Stipendium an die Columbia University in New York, 1996-99 war er Kulturattaché am Slowenischen Konsulat in New York. 2001 hatte er eine Gast pr ofessur für Kreatives Schreiben an der University von Massachusetts in Amherst, 2003 ein DAAD-Stipendium in Berlin. Salamun war mit der Künstlerin Metka Krasovec verheiratet, mit der er in Ljubljana lebte.
Salamun nannte sich selber ein „Ungeheuer“, wohl weil er im Schreiben das Ungeheuerliche der menschlichen Seele erkundet und dabei die Grenzen und Regeln seiner Sprache, dem Slowenischen, aufs pr engt. Seine Gedichte verbinden das Experimentelle und Visionäre der europäischen Lyrik mit der Provokation und Nüchternheit der nordamerikanischen Dichter. Er hat die Welt bereist, aber im Leben wie im Schreiben blieb er seinem Land verbunden – einem Land, das im Laufe der Jahrhunderte immer wieder fremderobert wurde. Seit seine Gedichte vor allem ins Englische, aber auch in ein Dutzend andere Sprachen übersetzt worden waren, gehörte Salamun zur amerikanischen Literaturszene, Charles Simic, Phillis Levin u. a. haben seine Gedichte übersetzt. Seine Poetik der Rebellion ist eine Negation ohne Programm, ein Akt der Selbst-Befreiung und offenen Suche. Schnell, spielerisch, absurd, gegenwarts prall – so kommen seine Gedichte daher, zuweilen auch zärtlich und sensitiv. Es mag nicht zuletzt diese stilistische Vielfalt sein, der Salamun seine Popularität in Slowenien verdankt. Witzig, elegant und provokant entsteht ein Sprung in die Mitte der eigenen Imagination, dorthin, wo sich persönliche Freiheit entfaltet und wo das Erhabene zu ahnen ist.
Salamuns jüngste Gedichtsammlung in deutscher Übersetzung „Lesen. Lieben. Gedichte aus vier Jahrzehnten“ erschien 2006. Er verstarb am 27. Dezember 2014.
© internationales literaturfestival berlin
Ein Stengel Petersilie im Smoking
Fischer
Frankfurt/Main, 1972
Übersetzung: Peter Urban
Maske
Mladinska Knjiga
Ljubljana, 1980
Mera casa
Cankarjeva zalozba
Ljubljana, 1987
Poker
Cankarjeva zalozba
Ljubljana, 1989
Wal
Droschl
Graz, 1990
Übersetzung: Fabjan Hafner
Morje
Nova revija
Ljubljana, 1999
Amerika
Mondena
Grosuplje, 2000
Vier Fragen der Melancholie
Korrespondenzen
Wien, 2003
Übersetzung: Peter Urban
Aber das sind Ausnahmen
Korrespondenzen
Wien, 2004
Übersetzung: Peter Urban
Ballade für Metka Krasovec
Korrespondenzen
Wien, 2005
Übersetzung: Fabjan Hafner
Lesen. Lieben. Gedichte aus vier Jahrzehnten
Suhrkamp
Frankfurt/Main, 2006
Übersetzung: Fabjan Hafner
Übersetzer: Michael Biggins, Fabjan Hafner, Peter Urban