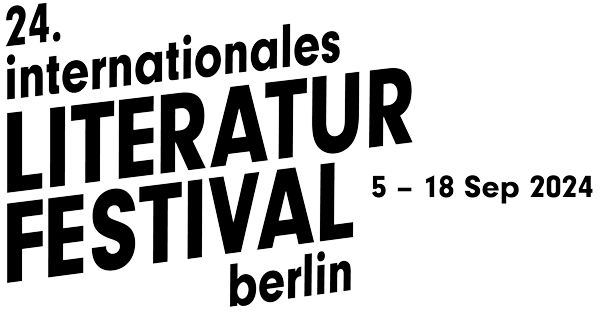Michel Deguy
- Frankreich
- Zu Gast beim ilb: 2002
In den USA, in Italien, Polen oder Ungarn sind bereits Anthologien mit Texten von Michel Deguy erschienen – nicht so in Deutschland. Hierzulande finden sich unverständlicherweise nur Bruchstücke seines mittlerweile mehr als 40 Jahre umspannenden Werkes, verstreut in einigen Anthologien zur französischen Gegenwartslyrik oder in Zeitschriften wie „Lettre International“, „Wespennest“ oder „PARK“. Dabei gehört der 1930 in Paris geborene Schriftsteller seit langem zu den herausragenden Vertretern einer Wortkunst, die sich um traditionelle Gattungsbezeichnungen nur wenig kümmert, in der freie Verse gleichberechtigt neben Reflexionen in Prosaform stehen. In Frankreich hat seine Dichtung den verlegerischen Gipfel schon erreicht: In der prestigereichen Reihe „Poésie / Gallimard“ ist 1999 bereits der dritte Band mit seinen in chronologischer Ordnung versammelten Schriften erschienen (Ouï dire. Poèmes I, 1960-1970; Poèmes II, 1970-1980; Gisants. Poèmes III, 1980-1995); dort befindet sich sein Werk in der unmittelbaren Nachbarschaft von Paul Eluard und Francis Ponge, René Char und Apollinaire. Deguy selbst hat sich nie als Dichter gesehen, er selbst bezeichnet sich in respektvoller Distanz als „Dichter, der ich zu sein versuche“. Daneben ist er aber auch Übersetzer – er hat unter anderem Heidegger und Paul Celan ins Französische übertragen; als Wissenschaftler – ursprünglich Philosoph, war er bis 1999 Universitätsprofessor für französische Literatur in Paris und von 1989 bis 1992 zudem Präsident des unter anderen von ihm und Jacques Derrida mitbegründeten „Collège International de Philosophie“; und nicht zuletzt ein einflußreicher ‚Literaturbetreiber‘: so war er bis 1986 Lektor bei Gallimard und ist heute unter anderem Chefredakteur der Zeitschrift „Po&Sie“. Die dort gesammelten Erfahrungen über das Innenleben des Literaturbetriebs finden sich literarisch wie kritisch verarbeitet in „Le comité. Confessions d’un lecteur de Grande Maison“ (1987). In seiner kreativen Arbeit zeigt Deguy sich stets bemüht, poetologische Reflexionen und poetische Praxis miteinander zu verknüpfen. Für ihn ist Dichtung ein „Sein wie“ – das Wörtchen comme ist für ihn die ausschlaggebende Konjunktion – und die Bestimmung des Dichters besteht darin, im Medium der Sprache eine Analogie der Wirklichkeit zu schaffen: „Dichtung kann nur im Vergleich mit dem ausgesprochen (gedacht) werden, das sie benennt; sie ist wie; sie ist wie die Dinge, über die sie unversehens spricht, denn sie sucht in ihnen Gestalt.“ So offenbart sich in seinen Texten einerseits ein theoretisch anspruchsvolles Verständnis dichterischer Sprache; andererseits greift Deguy immer wieder in kritischer Absicht die Auswüchse einer Kultur an, die von ihm als „Kulturelles“ sehr gering geschätzt wird. In den letzten Jahren hat das Nachdenken über den Tod einen wichtigen Platz in Deguys Schaffen eingenommen. 1991 erhielt er einen Preis für seinen Essay über einem Film des französischen Regisseurs Claude Lanzmann über die Vernichtung der Juden (Au sujet de Shoah. Le film de Claude Lanzman, 1990); 1995 verfaßte er eine Totenklage auf seine verstorbene Frau (A ce qui n’en finit pas: thrène) – die darin enthaltenen Gedichte finden sich nicht in dem dritten Band seiner „Poèmes“: Deguy wollte diese wohl intimsten seiner Texte nicht neben andere gestellt sehen.
Dirk Naguschewski
© internationales literaturfestival berlin
Poèmes de la Presqu´ile
Gallimard
Paris, 1961
Actes
Gallimard
Paris, 1966
Oui dire
Gallimard
Paris, 1966
Figurations
Gallimard
Paris, 1969
Tombeau de Du Bellay
Gallimard
Paris, 1973
La machine matrimoniale
Gallimard
Paris, 1981
Donnant, donnant
Gallimard
Paris, 1981
Choses de la poésie et affaire culturelle
Hachette
Paris, 1986
La poésie n´est pas seule: court traité de poétique
Seuil
Paris, 1988
Le comité. Confessions d´un lecteur de grand maison
Champ Vallon
Seyssel, 1988
À ce qui n´en finit pas : thrène
Seuil
Paris, 1995
Gisants. Poèmes III 1980-1995
Gallimard
Paris, 1999
La raison poétique
Galilée
Paris, 2000
L´impair
Farrago
Tours, 2001
Au jugé
Galilée
Paris, 2004
Le sens de la visite
Stock
Paris, 2006
Donnant donnant
poèmes 1960-1980
Gallimard
Paris, 2006
Desolation
Galilée
Paris, 2007
Réouverture après travaux
Galilée
Paris, 2007
Übersetzer: Leopold Federmair