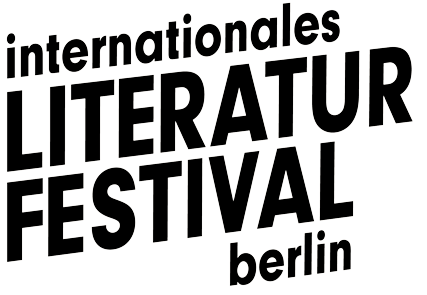Manuel Rivas
- Spanien
- Zu Gast beim ilb: 2002, 2009
Manuel Rivas wurde 1957 in der galicischen Hafenstadt La Coruña geboren. Nach dem Abitur ging er nach Madrid, um dort Informatik zu studieren. Schon in jungen Jahren schrieb er für verschiedene Tageszeitungen literarische und journalistische Texte. Diese zweigleisige Betätigung zugleich als Schriftsteller und Journalist zu arbeiten, hat er beibehalten. Wie ein Panorama der literarischen Formen liest sich sein Werkverzeichnis: neben Romanen und Erzählungen sind darin Gedichte, Essays, Kolumnen und Drehbücher zu finden. Das Geschichtenerzählen, verriet Manuel Rivas einmal, habe er in den Hafenspelunken gelernt, und stets hätten ihn die einfachen Menschen fasziniert. Die meisten seiner Romane spielen an den Rändern des europäischen Kontinents, jenseits der großen Städte und ihrer neurotischen Bewohner. Hafenarbeiter und Fischer beleben die Szenerien, Bauern, Pilger und die vielen Emigranten, die Galicien, dieser arme, staubige Landstrich, hervorgebracht hat. Das Spanien des 20. Jahrhunderts und seine historisch-mythischen Schichten sind in Rivas’ Romanen so eng miteinander verschränkt, dass die Figuren gleichzeitig in verschiedenen Räumen und Zeiten zu wandeln scheinen. Momentaufnahmen vergangenen Glücks, phantastische Gedanken oder Relikte von Aberglauben und Alltagsmythologie treffen auf die gegenwärtige Welt der Industriewüsten, ökonomische Zwänge und modernen Medien. Eine solche Sphäre der mythischen Gleichzeitigkeit entwirft Manuel Rivas etwa in seinem Roman „En salvaxe compaña“ (1994; „In wilder Gesellschaft“ 1998). Schauplatz ist das galicische Dorf Arán, in dem nur noch alte Kirchengemälde und ein Herrenhaus an die einstmals glänzende Feudalzeit erinnern. In diesem aus der Gegenwart geworfenen Ort, der die Menschen zu lethargischen, einzig der Erinnerung verhafteten Wesen macht, lebt Rosa, Hausfrau und Mutter, die im Trott des Kochens und Kinderfütterns unterzugehen droht. Um sich zu retten, lässt sie sich Geschichten erzählen – und nach und nach fangen sogar die Tiere zu fabulieren an, spannen Katzen, Mäuse, Raben und Eidechsen ein Universum des Phantastischen auf, in dem die Lebenden und die Toten wieder miteinander sprechen können. Jene den Roman prägende Diktion des „assoziativen Denkens“, die sich aus bewusst gesetzten stilistischen Brüchen, Zeitsprüngen, Symbolen und einer meist genau durchgearbeiteten Sprache speist, findet sich auch in Manuel Rivas’ Roman „O lapis do carpinteiro“ (1998; „Der Bleistift des Zimmermanns“ 2000). Er handelt von den Überlebensstrategien eines Intellektuellen in einem faschistischen Gefängnis während des Spanischen Bürgerkrieges. Auch hier ist es das Refugium von Phantasie, Liebe und Erinnerung, das der Hauptfigur ihr Überleben sichert. In dem Roman „El héroe“ ( 2006; Ü: Der Held) liefert der “geheime Krieg” von Sidi Ifni, der letzte Kolonialkrieg Spaniens, den historischen Hintergrund für die Geschichte des Protagonisten Arturo Piñeiro. Mit seinem bislang letzten Roman „Los libros arden mal“ (2006; Ü: Bücher brennen schlecht) hat Rivas eine Art dramatische Kulturgeschichte vorgelegt. Er verknüpft die Geschichten von Büchern, Menschen und Sprache zu einem spannungsreichen Beziehungsgeflecht, das sich vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart erstreckt.
Auf eine bestimmte Haltung festlegen konnte man Manuel Rivas’ Schreiben tatsächlich nie. Dazu ist seine Literatur zu zwiespältig, zu gebrochen, oszilliert zu sehr zwischen dem Klang galizischer Lyrik und der Tradition mündlichen Erzählens, zwischen dem „magischen Realismus“ eines Gabriel García Márquez und den narrativen Schnitttechniken eines Raymond Carver. So führt er in seinen Texturen Leben und Sprache, Tradition und Moderne zusammen – ein vielsprachiger Archäologe der Erinnerungsschichten: „Vielleicht ist genau das die Aufgabe der Literatur: mit Zeit und Erinnerung die Schatten der Menschen zu heilen“. Neben seinen Romanen und Erzählungen sind bislang vier Bände mit Rivas‘ journalistischen Arbeiten und ein Gedichtband erschienen. Der Autor lebt in der Nähe seiner Geburtsstadt La Coruña.
© internationales literaturfestival berlin
¿Que me queres, amor?
Galaxia
Vigo, 1995
O pobo da noite
Xerais de Galicia
Vigo, 1996
In wilder Gesellschaft
Suhrkamp
Frankfurt/Main, 1998
Übersetzung: Elke Wehr
Der Bleistift des Zimmermanns
Suhrkamp
Frankfurt/Main, 2000
Übersetzung: Elke Wehr
Die Nacht, in der ich auf Brautschau ging
Suhrkamp
Frankfurt/Main, 2002
Übersetzung: Elke Wehr
La lengua de las mariposas
Cornelsen
Berlin, 2004
El héroe
Alfaguara
Madrid, 2006
Los libros arden mal
Alfaguara
Madrid, 2006
Übersetzerin: Elke Wehr