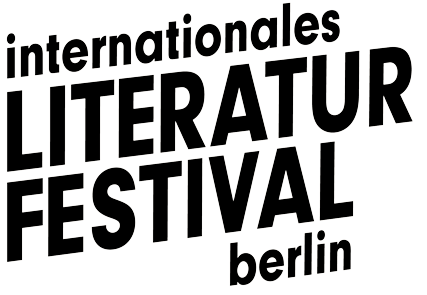Ljudmila Petruschewskaja
- Russland
- Zu Gast beim ilb: 2003
Ljudmila Petruschewskaja wurde 1938 in Moskau geboren. Sie entstammt einer Intellektuellenfamilie, die über mehrere Generationen, bis zum Beginn der Perestroika, Repressalien ausgesetzt war. Petruschewskaja absolvierte an der Lomonossow-Universität ein Journalistikstudium und arbeitete anschließend von 1957 bis 1973 als Rundfunk- und Fernsehjournalistin. In den Jahren 1974 bis 1982, als sie ihre Werke nicht veröffentlichen konnte, arbeitete sie bei der Literaturzeitschrift „Nowyi Mir“.
Ab 1963 schrieb sie ihre ersten Prosastücke. Ihre Erzählungen protokollieren schonungslos und mit dokumentarischer Genauigkeit die Schattenseiten sowjetischer und postsowjetischer Realität. Sie erzählen von verschwundenen Vätern und alkoholsüchtigen Müttern, von verwahrlosten Kindern und den vergessenen Alten. Sie beschreiben den Kampf ums Überleben im alltäglichen Organisieren und die klaustrophische Enge in zu kleinen Wohnungen. Petruschewskajas Prosa ist zuweilen nüchtern und lakonisch, dann wieder gehetzt, voller Brüche, schiefer Metaphern und Wiederholungen. Nähere Erläuterungen werden nachgeschoben oder in Klammern gesetzt. Wie bei Tschechow, mit dem Petruschewskaja oft verglichen wird, blitzt in der mehrschichtigen Rede der Figuren das Tragische nur in kurzen Anspielungen auf, um sogleich wieder von leeren Worthülsen und Alltagsgeschwätz überdeckt zu werden. Seit den siebziger Jahren hat Petruschewskaja über 30 Dramen verfasst. Zu den bekanntesten Stücken gehört der Einakter „Cinzano“ (1973, dt. unter demselben Titel 1989). Daneben entstanden in den neunziger Jahren auch Märchen, die in Deutschland in den Bänden „Der Mann, der wie eine Rose roch“ (1993) und „Die neuen Abenteuer der schönen Helena“ (1998) veröffentlicht wurden. Ihre neuere Erzählprosa weist einen Zug ins Phantastische auf. In dem Erzählband „Der schwarze Mantel“ (1999) trifft ein Mädchen den Geist des russischen Dichters Alexander Blok in der Datscha ihrer verstorbenen Tante, und eine Frau, deren Sohn Selbstmord vorgetäuscht hat, um an ihre Ersparnisse zu gelangen, befragt einen alkoholkranken Sterbenden, der christusähnliche Züge aufweist, um sich am Ende mit der Relativität ihres eigenen Elends zu trösten.
Petruschewskajas Geschichten deckten sich nicht mit dem von der Partei vorgegebenen heroischen Bild des Arbeiter- und Bauernstaates und unterlagen zum großen Teil der Zensur. Erst im Zuge der Perestroika konnten die Erzählungen und Dramen veröffentlicht werden. Heute zählt sie zu den bekanntesten Autorinnen Russlands. Sie wurde mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet. 1995 erschien in Russland eine fünfbändige Werkausgabe. Petruschewskaja lebt in Moskau.
© internationales literaturfestival berlin
Cinzano
Luchterhand
Frankfurt/Main, 1989
Übersetzung: Rosemarie Tietze
Unsterbliche Liebe: Erzählungen
Volk und Welt
Berlin, 1990
Übersetzung: Antje Leetz und Renate Landa
Meine Zeit ist die Nacht: Aufzeichnungen auf der Tischkante
Rowohlt
Berlin, 1991
Übersetzung: Antje Leetz
Der Mann, der wie eine Rose roch: Märchen
Fischer
Frankfurt/Main , 1993
Übersetzung: Antje Leetz
Auf Gott Amors Pfaden und andere Erzählungen
Rowohlt
Berlin, 1994
Übersetzung: Antje Leetz
Die neuen Abenteuer der schönen Helena: Märchen für Erwachsene
Berlin -Verlag
Berlin, 1998
Übersetzung: Antje Leetz
Dom devušek
Vagrius
Moskau, 1998
Der schwarze Mantel: Erzählungen
Berlin -Verlag
Berlin, 1999
Übersetzung: Antje Leetz
Najdi menja, son
Vagrius
Moskau, 2000
Most Vaterloo
Vagrius
Moskau, 2001
Èemodan èepuchi
Vagrius
Moskau, 2001
Èernoe pal’to
Vagrius
Moskau, 2002
Gde ja byla
Vagrius
Moskau, 2002
Devjatyj tom
Eksmo
Moskau, 2003
Dom s fontanom
Vagrius
Moskau, 2003
Nomer Odin, ili V sadach drugich vozmožnostej
Eksmo
Moskau, 2004
Boginja parka
Eksmo
Moskau, 2004
Izmenennoe vremja
Amfora
St. Petersburg, 2005
Gorod sveta
Amfora
St. Petersburg, 2005
Malenkaja devotschka iz „Metropolja“
Amfora
St. Petersburg, 2006
Übersetzer: Renate Landa, Antje Leetz, Esther Kinsky