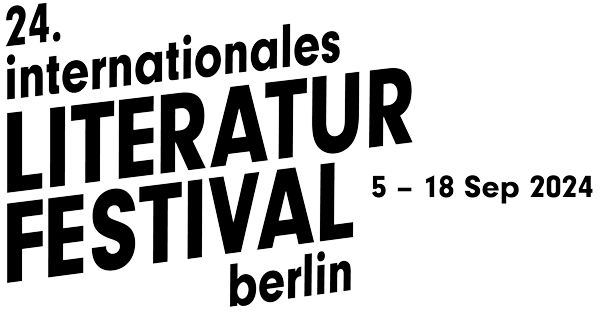Kenzaburô Ôe
- Japan
- Zu Gast beim ilb: 2005
Kenzaburô Ôe wurde 1935 im Dorf Ôse auf der japanischen Insel Shikoku als Sohn einer Grundbesitzerfamilie geboren. Er studierte bis 1959 Französische Literatur an der Universität Tokio und schloss mit einer Arbeit über Sartre ab. Während des Studiums veröffentlichte er erste literarische Werke, die früh Anerkennung fanden. So erhielt er 1958 für die Erzählung »Shiiku« (dt. »Der Fang«, 1964) die wichtigste literarische Auszeichnung Japans, den Akutagawa-Preis. Seine Herkunft aus der japanischen Provinz und die Hinwendung zur europäischen Kultur prägten Ôe. In Abgrenzung zu nationalistischen Tendenzen und der Tenno-Kultur entwickelte er ein breit gefächertes Interesse für westliche Philosophie, Literatur und Mystik. 1960 heiratete er seine Frau Yukari, mit der er drei Kinder hat. 1963 wurde sein geistig behinderter Sohn Hikari geboren, ein Umstand, der Ôes Leben von Grund auf änderte. In seinem Roman »Kojintekina taiken« (1964; dt. »Eine persönliche Erfahrung« 1972), mit dem er auch internationale Anerkennung erlangte, wird sein fiktives Alter Ego vor die Wahl gestellt, sein behindertes Neugeborenes zu töten oder am Leben zu lassen. Weitere Themen, die Ôe in seinen Romanen variiert, sind ebenfalls eng an autobiografische Erfahrungen angelehnt, so z.B. das Leben in einem abgeschiedenen Dorf zur Zeit der japanischen Kapitulation nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Protagonisten seiner Romane sind Anti-Helden: zumeist im jeweiligen Alter des Autors, durchleben sie existentielle Krisen, sind von Verzweiflung, Einsamkeit und sexueller Entfremdung geplagt. Das besondere Merkmal der vielschichtigen Ôeschen Erzählkunst liegt jedoch in der Kontrastierung der verzweifelten Lage seiner Figuren mit einem eigenwilligen schwarzen Humor, hinter dem selbst in den härtesten Stunden der Glaube an die Humanität aufscheint.
In den siebziger und achtziger Jahren unternahm Ôe zahlreiche Vortrags- und Kongressreisen ins Ausland, die auch sein Engagement auf politischem Gebiet widerspiegeln; so war Ôe schon seit den sechziger Jahren Mitglied der japanischen Anti-Atom-Bewegung und setzte sich für die internationale Umwelt- und Friedensbewegung ein. Ôe, der die Rolle des Schriftstellers einmal mit der des Kanarienvogels im Kohleschacht verglich, gilt als das »moralische Gewissen« seines Landes und ist in seiner Heimat starken Anfeindungen von konservativer Seite ausgesetzt.
1994, nach Abschluss seiner Romantrilogie »Moeagaru midori no ki« (dt. »Grüner Baum in Flammen«, Bd. 1 unter demselben Titel, 2000; Bd. 2 »Der schwarze Ast«, 2002; Bd. 3 »Der atemlose Stern«, 2003), gab Ôe bekannt, dass er sich fortan dem Werk Spinozas widmen und sich vom Schreiben zurückziehen wolle. Wenige Wochen nach dieser Verlautbarung wurde ihm jedoch der Nobelpreis für Literatur verliehen, und er nahm wieder Abstand von seinem Vorhaben. Seitdem arbeitet Ôe an einer Romanfolge, die wiederum autobiografisches Material zur Grundlage hat. In deutscher Übersetzung erschien zuletzt der erste Band »Tagame. Berlin – Tokyo« (2005). Ôe lebt in Setagaya, einem Vorort westlich von Tokio.
© internationales literaturfestival berlin
Die Brüder Nedokoro
Suhrkamp
Frankfurt/Main, 1980
Übersetzung: Rainer und Ingrid Rönsch
Der stumme Schrei
Fischer
Frankfurt/Main, 1994
Übersetzung: Rainer Rönsch
Verwandte des Lebens
bebra
Berlin, 1994
Übersetzung: Jaqueline Berndt, Hiroshi Yamane
Stolz der Toten
Fischer
Frankfurt/Main, 1994
Übersetzung: Margarete Donath, Itsuko Gelbrich
Und plötzlich stumm
Aufbau
Berlin, 1994
Übersetzung: Jürgen Berndt, Eiko Saito-Berndt
Therapiestation
bebra
Berlin, 1995
Übersetzung: Verena Werner
Gestern, vor 50 Jahren
[mit Günther Grass]
Steidl
Göttingen, 1995
Übersetzung: Otto Putz
Der Tag, an dem Er selbst mir die Tränen abgewischt
Suhrkamp
Frankfurt/Main, 1995
Übersetzung: Siegfried Schaarschmidt
Reißt die Knospen ab
Suhrkamp
Frankfurt/Main, 1997
Übersetzung: Otto Putz
Stille Tage
Insel
Frankfurt/Main 2000
Übersetzung: Ursula Gräfe, Wolfgang Schlecht
Grüner Baum in Flammen
Suhrkamp
Frankfurt/Main, 2000
Übersetzung: Annelie Ortmanns
Eine persönliche Erfahrung
Suhrkamp
Frankfurt/Main, 2000
Übersetzung: Annelie Ortmanns
Der Fang
Suhrkamp
Frankfurt/Main, 2001
Übersetzung: Tatsuji Iwabuchi
Der schwarze Ast
Fischer
Frankfurt/Main, 2002
Übersetzung: Nora Bierich
Der kluge Regenbaum
Fischer
Frankfurt/Main, 2003
Übersetzung: Buki Kim, Siegfried Schaarschmidt, Ingrid Rönsch
Der atemlose Stern
Fischer
Frankfurt/Main, 2003
Übersetzung: Nora Bierich
Tagame. Berlin – Tokyo
Fischer
Frankfurt/Main, 2005
Übersetzung: Nora Bierich
Übersetzer: Nora Bierich, Buki Kim, Amelie Ortmanns, Siegfried Schaarschmidt