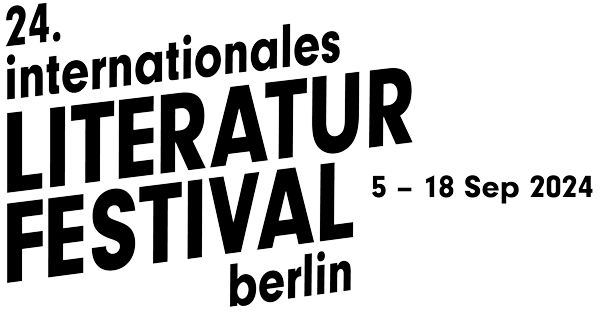Jesús Ferrero
Jesús Ferrero wurde 1952 in der spanischen Provinz Zamora geboren. Nach dem Schulabschluss studierte er für kurze Zeit Literaturwissenschaft in Zaragoza und zog dann nach Paris, um an der Sorbonne ein Studium der altgriechischen Geschichte aufzunehmen. Seit 1995 lebt er in Madrid, wo er Literatur unterrichtet. Jesús Ferrero gehört wie Javier Marías oder Antonio Muñoz Molina zu den Autoren jener neuen spanischen Prosa, die sich nach der „movida“, einer frühen postmodernistischen Strömung, herauskristallisierte. Er hat zahlreiche Romane, Gedichtbände, Novellen, Essays und Drehbücher geschrieben. Er ist u.a. Co-Autor von Pedro Almodóvars Film „Matador“. Jesús Ferreros Texte sind eine Renaissance der alten Mythen, erzählen aber genauso von den banalen, manchmal absurden Geschichten des Alltags. Sie reflektieren die Utopien des zwanzigsten Jahrhunderts, wie die von „Metropolis“. Ferreros Stil wird mit Cervantes oder Kafka in Verbindung gebracht. Der Autor liebt es, klassische Erzählmuster aufzunehmen, indem er sie modernisiert und mit neuen Stilmitteln ästhetisch vereinnahmt. Einer präzisen Choreographie folgt Ferreros Buch „El Efecto Doppler“ (1990) („Rosauras Liebhaber oder Der Dopplereffekt“ 2001). Der Protagonist Darío wird dabei systematisch in eine komplexe Geschichte verstrickt. Während eines Abendessens in Paris jagt sich die junge Rosaura vor den Gästen eine Kugel durch den Kopf: „Plötzlich schaute sie mich an und holte eine Pistole aus der Tasche. Ohne mit dem Pfeifen aufzuhören, hielt sie sich die Waffe an die Schläfe.“ Jede Geste, jeder Blick, folgt einer Art geheimen Botschaft, und Darío, Rosauras Cousin, macht es sich zur Aufgabe, all die Spuren, die scheinbar in keinem Zusammenhang stehen, zu einem sinnvollen Ganzen zu fügen. In einer ruhigen und überaus präzisen Sprache, in einer detailliert ausgeklügelten Romankonstruktion erzählt Ferrero eine packende Liebesgeschichte und stellt darin zugleich Reflexionen über die Grenzen der Wahrnehmung an. Präzise ist auch jener Blick, über den der Held des Romans „El diablo en los ojos“ (1998) verfügt. Seitdem der junge Leo Salgado zum ersten Mal das Objektiv seiner Kamera auf die eigene Familie gerichtet hat, spürt er den starken Einfluss dieses Instruments, das in der Lage ist, die alltäglichen Kleinigkeiten und ihre intimsten Facetten festzuhalten. Die Kamera ist hier der heranwachsende dichterische Genius, der mit fast grausamer Deutlichkeit den Zerfall der Familie einfängt. In dem Roman „Juanelo o el hombre nuevo“ (2000) versetzt Jesús Ferrero seine Geschichte ins Toledo des 16. Jahrhunderts. Der Protagonist der phantastischen Geschichte, ein schöner Jüngling, erfährt nach und nach die grausame Geschichte seiner eigenen Herkunft, je mehr er sich in die Geschehnisse der Stadt Toledo verstrickt. Es wird offenbar, dass er ein künstlich geschaffener Mensch ist, ein Golem, ein im Wortsinne neuer Mensch. Geradezu beispielhaft führt der Roman noch einmal Ferreros Grundthemen vor Augen: „Die Zerstörung beginnt mit dem ersten Weinen in der Wiege und endet, wenn in unseren pergamentartigen Händen die Zeit stirbt.“
© internationales literaturfestival berlin
Opium
Plaza y Janés
Barcelona, 1986
Lady Pepa
Plaza y Janés
Barcelona, 1988
Alis el Salvaje
Plaza & Janés
Barcelona, 1991
El secreto de los dioses
Plaza y Janés
Barcelona, 1993
Amador o la narración de un hombre afortunado
Planeta
Barcelone, 1996
El último banquete
Planeta
Barcelona, 1997
El diablo en los ojos
Planeta
Barcelona, 1998
Bélver Yin
Alfaguara
Madrid, 2000
Juanelo, o, El hombre nuevo
Alfaguara
Madrid, 2000
Rosauras Liebhaber oder der Dopplereffekt
Orgler
Frankfurt/Main, 2001
Übersetzung: Petra Siegmann
Zirze piernas largas
Siruelo
Madrid, 2002
Las noches rojas
Siruelo
Madrid, 2003
Angeles en el abismo
Siruelo
Madrid, 2005