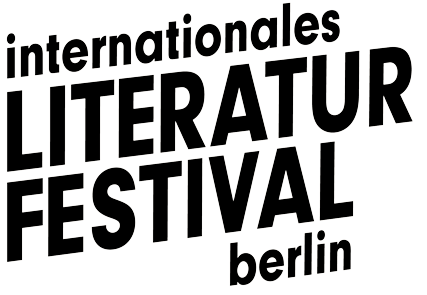Imre Kertész
- Ungarn
- Zu Gast beim ilb: 2003
Imre Kertész wurde 1929 in Budapest, Ungarn, als Sohn jüdischer Eltern geboren. Mit fünfzehn Jahren wurde er nach Auschwitz deportiert, 1945 aus dem KZ Buchenwald befreit. Nach Kriegsende war Kertész im kommunistischen Ungarn als Journalist bei der Tageszeitung „Vilagosság“ tätig, verlor dann aber seine Stelle, als die Zeitung parteitreu wurde. Um sich seinen Lebensunterhalt zu sichern, schrieb er Musicals und Unterhaltungsstücke. Ab 1976 arbeitete er auch als Übersetzer. Er übertrug u. a. Nietzsche, Freud, Wittgenstein, Hofmannsthal, Canetti, Josef Roth, Schnitzler und Tankred Dorst ins Ungarische. Zwischen 1960 und 1973 verfasste er den Holocaust-Roman „Sorstalanság“ („Schicksallosigkeit“), der 1975 in Ungarn veröffentlicht wurde, dort aber erst 1985 Beachtung fand. Die 1996 publizierte Neuübersetzung (dt. „Roman eines Schicksallosen“) verhalf Kertész, der inzwischen zahlreiche Essays, Erzählungen und Romane veröffentlicht hatte – so etwa „Der Spurensucher“ (1977, dt. 2002), „Die englische Flagge“ (1991, dt. 1999) oder das „Galeerentagebuch“ (1992, dt. 1993) – zum internationalen Durchbruch.
Kertész’ Schreiben kreist um die Erfahrung des Todeslagers. Im autobiographisch geprägten „Roman eines Schicksallosen“ schildert Kertész mit höchster Sensibilität und rationaler Distanz den Leidensweg eines fünfzehnjährigen Jungen, der ins KZ deportiert und nach seiner Befreiung mit dem Unverständnis der Menschen in Budapest konfrontiert wird. Dieser Roman bildet zusammen mit den Bänden „Fiasko“ (1988; dt. 1999) und „Kaddisch für ein nichtgeborenes Kind“ (1990; dt. 1992) eine „Trilogie der Schicksallosigkeit“. In „Fiasko“ zeichnet Kertész die schwierige Entstehungsgeschichte des Romanerstlings und die Existenz eines Schriftstellers unter den Bedingungen der kommunistischen Diktatur nach. Im Roman „Kaddisch für ein nicht geborenes Kind“ geht es um die bleibenden Folgen der Shoa. In Form eines Trauergebets gibt das Buch den Monolog eines Schriftstellers und Holocaust-Überlebenden wieder, der nach Auschwitz kein neues Leben mehr zeugen will. Neben diversen Auszeichnungen erhielt Kertész 2002 ein Stipendium am Wissenschaftskolleg in Berlin, wo er an seinem neuen Roman „Liquidation“ arbeitete, der im Ungarn zur Zeit der politischen Wende angesiedelt ist, und mit dem er, wie er selbst sagt, einen letzten Blick auf den Holocaust werfe. Im Dezember 2002 wurde Kertész mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Die Jury würdigte damit sein Werk, „das die zerbrechliche Erfahrung des Einzelnen gegenüber der barbarischen Geschichte behauptet“. 2004 wurde er mit der Goethe-Medaille geehrt und ein Jahr später verlieh ihm die Freie Universität Berlin die Ehrendoktorwürde. Kertész lebte er in Budapest und Berlin. Er verstab am 31. März 2016.
© internationales literaturfestival berlin
Kaddisch für ein nicht geborenes Kind
Rowohlt
Berlin, 1992
Übersetzung: György Buda, Kristin Schwamm
Eine Geschichte: Zwei Geschichten
Residenz
Salzburg, 1992
Übersetzung: Kristin Schwamm, Hans Skirecki
Roman eines Schicksallosen
Rowohlt
Berlin, 1996
Übersetzung: Christina Viragh
Ich – ein anderer
Rowohlt
Reinbek, 1999
Übersetzung: Ilma Rakusa
Eine Gedankenlänge Stille. Während das Erschießungskommando neu lädt
Rowohlt
Reinbek, 1999
Übersetzung: György Buda
Galeerentagebuch
Rowohlt
Reinbek, 1999
Übersetzung: Kristin Schwamm
Fiasko
Rowohlt
Reinbek, 2001
Übersetzung: György Buda, Agnes Relle
Die englische Flagge
Rowohlt
Reinbek, 2002
Übersetzung: György Buda, Kristin Schwamm
Liquidation
Suhrkamp
Frankfurt/Main, 2003
Übersetzung: Christina Viragh
Die exilierte Sprache: Essays und Reden
Suhrkamp
Frankfurt/Main, 2003
Übersetzung: Kristin Schwamm
Detektivgeschichte
Rowohlt
Reinbek, 2004
Übersetzung: Angelika und Peter Máté
Dossier K.
Rowohlt
Reinbek, 2006
Übersetzung: Kristin Schwamm
Übersetzer: Erich Berger, György Buda, Geza Dereky, Krisztina Koenen, Laszlo Komitzer, Ingrid Krüger, Angelika und Peter Máté, Ilma Rakusa, Agnes Relle, Kristin Schwamm, Christina Viragh