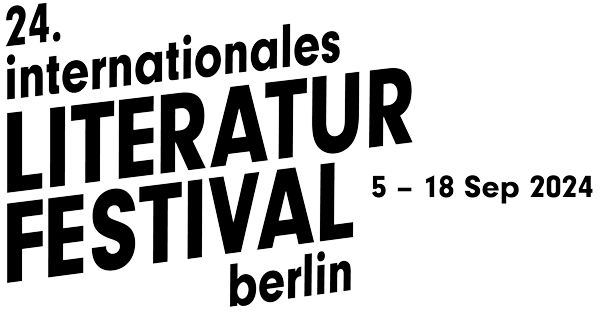Giwi Margwelaschwili
„Als ich mich 1983 zu einer Reise nach Georgien anschickte, empfahlen mir Elke Erb und Adolf Endler, den seltsamen Dissidenten Giwi Margwelaschwili zu besuchen, einen Schriftsteller, der dort auf Deutsch schreibe. Giwi empfing mich auf seiner „Wartburg“ in Tbilissi mit Swing von Benny Goodman. Eine „Wartburg“, das erfuhr ich sogleich bei der Lektüre von Giwis autobiographischem Roman „Kapitän Wakush“, ist eine Wohnung mit jedweder Art von Unzulänglichkeiten […]“, schrieb der Ostberliner Russland- und Georgienexperte Ekkehard Maaß. Giwi Margwelaschwili, Sohn georgischer Emigranten, wurde 1927 in Berlin geboren. Seine Mutter starb, als er vier Jahre alt war. Sein Vater lehrte in Berlin Philosophie und Orientalistik und war Mitarbeiter der georgischen Emigrantenzeitung „Kaukasus“. Im Februar 1946 wurde er zusammen mit seinem Vater, der zum Vorsitzenden der georgischen Emigrantenkolonie gewählt worden war, vom sowjetischen Geheimdienst NKWD aus dem westlichen Sektor in die Ostzone entführt. Nach der Trennung vom Vater, der im Gulag erschossen wurde, und sechs Wochen Bunkerhaft, kam Giwi Margwelaschwili in das sowjetische Internierungslager „Sachsenhausen“. Im Herbst 1947 wurde er nach Georgien verschleppt. Mit fremder Hilfe konnte er Germanistik studieren und am „Pädagogischen Fremdspracheninstitut Tbilissi“ als Deutschlehrer arbeiten. In dieser Zeit entstanden seine ersten Romane und Arbeiten zur phänomenologischen Philosophie. In den sechziger Jahren besuchte ihn Heinrich Böll und war beeindruckt vom ersten Band des „Kapitän Wakusch“ („In Deuxiland“, 1991, „Sachsenhäuschen“, 1992), konnte ihm jedoch auf Grund der Überwachung durch den KGB nicht weiterhelfen. 1971 wurde er an das Philosophische Institut der „Georgischen Akademie der Wissenschaften“ berufen. In den siebziger Jahren erhielt er, aufgrund des Kontaktes mit Wolf Biermann, ein bis 1987 andauerndes Ausreiseverbot. In der Perestroikazeit konnte erreicht werden, dass Giwi Margwelaschwili die DDR und Westdeutschland wiederholt besuchte. Es kam zur Veröffentlichung der ersten Bände seines umfangreichen literarischen Werkes. 1991 erschien der erste Band seines autobiographischen Roman „Muzal. Ein Georgischer Roman“, der u.a. von Dantes „Göttlicher Komödie“ inspiriert ist. Der stark von politischen Auseinandersetzungen geprägte Roman, der sich kritisch gegen gesellschaftliche Zwangssysteme wendet, ist von einem überlebensnotwendigen Humor durchsetzt. Die beiden Protagonisten des Romans sind „Lesefiguren“ aus einem georgischen Gedicht und werden herbeizitiert und aus dem Handlungsverlauf herausgerissen, um in der Phantasie des Lesers weiterzuexistieren. Neben Sammlungen seiner philosophischen Arbeit, publizierte Giwi Margwelaschwili zudem poetologische Schriften, so z.B. „Gedichtwelten-Realwelten“ (1994) zur Poetikvorlesung in Bamberg. 1994 erhielt er die deutsche Staatsbürgerschaft. Ihm wurde ein Ehrenstipendium des Bundespräsidenten verliehen. Zudem ist er Mitglied des P.E.N.. Im Dezember 1995 erhielt Margwelaschwili für sein Gesamtwerk den „Brandenburgischen Literatur-Ehrenpreis“, 2006 die Goethe-Medaille. Er lebt in Berlin.
© internationales literaturfestival berlin
Muzal
Insel
Frankfurt/Main, 1991
Das böse Kapitel
Rütten & Loening
Berlin, 1991
Zuschauerräume: Ein historisches Märchen
Autoren-Kollegium
Berlin, 1991
Die große Korrektur
Rütten & Loening
Berlin, 1991
Kapitän Wakusch
[Bd. 1: In Deuxiland]
Südverlag
Konstanz, 1991
Kapitän Wakusch
[Bd. 2: Sachsenhäuschen]
Südverlag
Konstanz, 1992
Der ungeworfene Handschuh
Rütten & Loening
Berlin, 1992
Leben im Ontotext: Poesie, Poetik, Philosophie
Federchen-Verlag
Neubrandenburg, 1993
Gedichtwelten-Realwelten
Fußnote 28
Bamberg, 1994