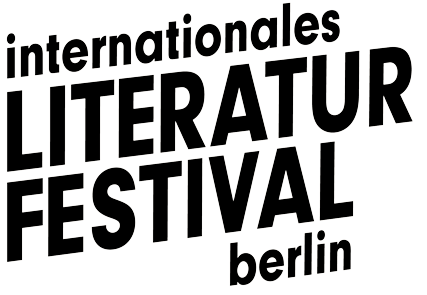Daniel Weissbort
- Großbritannien
- Zu Gast beim ilb: 2001
Daniel Weissbort wurde 1935 in London geboren. Zu Beginn seines Studiums in Cambridge lernte er den späteren Poet Laureate Großbritanniens, Ted Hughes, kennen. Mit ihm zusammen gründete Weissbort 1965 die Zeitschrift »Modern Poetry in Translation«, die auch heute noch erscheint. In den frühen 1970er Jahren ging er nach Amerika, wo er ab 1974 den Translation workshop an der Universität von Iowa leitete. Er war dort außerdem als Professor für Englisch und Komparatistik tätig. Weissbort war 1970-73 beratender Direktor des englischen Poetry International Committee, und gehört zahlreichen Kommissionen, unter anderem dem PEN American Center Translation Committee, an. Inzwischen ist er nach England zurückgekehrt, schreibt Gedichte, unterrichtet, hält Vorträge und arbeitet zusammen mit seiner Partnerin Valentina Polukhina an der Übersetzung und Verbreitung russischer Literatur. Bekannt ist Weissbort vor allem für seine Übersetzungen und Anthologien russischer und osteuropäischer Lyrik, aber auch für seine eigenen Gedichte. Seine Lyriksammlung »Letters to Ted« (2002) hat er seinem langjährigen Freund und Kollegen Ted Hughes gewidmet. 2006 veröffentlichte Weissbort außerdem in Zusammenarbeit mit Astradur Eysteinsson „Translation: Theory and Practise”, ein Buch über die Geschichte der Übersetzungstheorie.
Ted Hughes zufolge besteht die Besonderheit der Gedichte Weissborts in ihrer Natürlichkeit, ihrer Entspanntheit und in der Ehrlichkeit, mit der der Autor über sein verborgenes, privates Leben Auskunft gibt. Es sind Momentaufnahmen einer Innenschau – kurz, zum Teil aphoristisch, lassen sie gleichwohl tiefe Einblicke in Gefühlswelten, individuelle Wahrnehmungen und Gedankengänge zu. Private und politische Perspektiven kreuzen sich, wenn geschichtliche Ereignisse mit persönlichen Erlebnissen verknüpft werden, wenn etwa in »1945« das Ende des zweiten Weltkrieges mit einem ersten Erfolg im Cricketspiel assoziiert wird. Weissbort tritt in einen Dialog mit sich selbst, mit seinem alternden Körper, seinen Gedanken, seinen Erinnerungen, mit der Weltgeschichte ebenso wie mit der Lebensgeschichte seiner verstorbenen Eltern. Viele Gedichte zeigen sich dem Thema Erinnerung verpflichtet, enthalten Widmungen oder Anreden an tote oder verlorene Freunde. Wiederholt tritt das Motiv des Traums auf, das schreckhafte Aufwachen aus einem Alptraum etwa, dessen beklemmende Wirkung unüberwindbar bleibt: »And yet / for certain sins, though you wake / there is no forgiveness either«.
© internationales literaturfestival berlin
In an Emergency
Carcanet
Oxford, 1972
Soundings
Carcanet
Manchester, 1977
Russian Poetry, the Modern Period [Hg.]
University of Iowa Press
Iowa City, 1978
Leaseholder
Carcanet
Manchester, 1986
Translating Poetry: the double labyrinth [Hg.]
Macmillan
London, 1989
The Poetry of Survival [Hg.]
St. Martin´s Press
New York, 1991
Fathers
Nothern House
Newcastle, 1991
Nietzsche´s Attaché Case
Carcanet
Manchester, 1993
Periplus [Hg.]
Oxford University Press
New York, Delhi, 1993
What Was All the Fuss About?
Anvil
London, 1998
Letters to Ted
Anvil Press Poetry
London, 2002
Iraqi Poetry Today [Hg.]
King’s College London – University of London
London, 2003
From Russian with Love
Anvil Press Poetry
London, 2004
Contemporary Russian Women´s Poetry [Hg.]
Carcanet
Manchester, 2004
Translation: Theory and Practise (mit Astradur Eysteinsson)
Oxford University Press
Oxford, 2006
Übersetzer: Margitt Lehbert