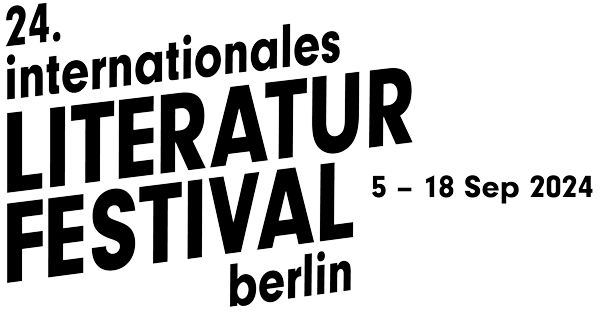Charles Simic
- Serbien, USA
- Zu Gast beim ilb: 2001
Charles Simic wurde 1938 in Belgrad, Serbien, geboren. Er wanderte 1953 in die USA aus und ließ sich 1954 in New York nieder. 1959 veröffentlichte Simic seine ersten Gedichte. Zwei Jahre später wurde er in die US Army eingezogen. Sein Studium an der New York University schloss er 1966 ab. Im Jahr darauf erschien sein erster eigener Lyrikband, »What the Grass Says«. Simic erhielt Stipendien, unter anderem von der Guggenheim Foundation, und lehrte an verschiedenen Universitäten. Seit 1973 unterrichtet er Englisch und Kreatives Schreiben an der Universität von New Hampshire. Neben Gedichten schreibt er auch Essays und übersetzt Lyrik aus dem Französischen, Serbischen, Kroatischen, Mazedonischen und Slowenischen. Er tritt außerdem als Herausgeber auf und hat auch ein Kinderbuch verfasst (dt. »Wo steckt Pepè?«). Für seine Prosagedichte, die 1990 unter dem Titel »The World Doesn’t End« veröffentlicht wurden, erhielt Simic den Pulitzer Prize for Poetry.
Seiner europäischen Herkunft zum Trotz gehört Simic wie Mark Strand und James Tate zu einer Generation von amerikanischen Dichtern, die in den 1960er Jahren als Surrealisten bekannt wurden. Seither widmen sich seine Geschichten den unterschiedlichsten Schauplätzen und Bildern, der Metropole New York ebenso wie den Städtchen Neuenglands. Die Lebensgeschichte des Dichters, seine Emigration aus einem von mehreren Kriegen erschütterten Land, ist von Bedeutung für sein lyrisches Werk. »Was schön ist,« schreibt er in einem Gedicht, »zeigt sich zufällig und nicht, weil man danach gesucht hat. Was schön ist, geht leicht verloren.«
Simic ist der Metaphysiker des Gewöhnlichen, ein Dichter, der uns an die Geheimnisse unseres Alltags erinnert. Was für Simic essentiell zu dieser Erfahrung hinzugehört, ist die Abwesenheit eindeutiger Ereignisse. »Die Komödie sagt genauso viel über die Welt aus wie die Tragödie«, schreibt er in einem seiner Essays. »Wer wahre Ernsthaftigkeit sucht, muss die Dinge von ihrer komischen wie von ihrer tragischen Seite betrachten.« Witz und Dichtung gehen bei Simic eine Symbiose ein, denn: »Humor wirkt subversiv, genauso wie die Dichtung.«
Die Spuren dieses »karnevalistischen« Weltempfindens lassen sich bis in Simics autobiografische Schriften, die bei der Kritik ebenfalls großen Anklang fanden, zurückverfolgen. In »A Fly in the Soup« (dt. »Eine Fliege in der Suppe«) erinnert sich der Autor auch an seine frühe Kindheit in Belgrad. Seinen eigentümlichen Authentizitätscharakter entfaltet dieser Text gerade durch die Offenheit für das Nebeneinander von lebensbedrohlichem Kriegsgeschehen und kindlicher Abenteuerlust.
© internationales literaturfestival berlin
Austerities
Braziller
New York, 1982
Unending Blues: Poems
Harcourt Brace
San Diego, New York, 1986
The World Doesn’t End
Harcourt Brace
New York, 1989
Nine Poems: a Childhood Story
Exact Change
Cambridge, 1989
Das Buch von Göttern und Teufeln
Hanser
München, 1993
[Ü: Hans Magnus Enzensberger]
A Wedding in Hell
Harcourt Brace
New York, 1994
Walking the Black Cat
Harcourt Brace
New York, 1996
Orphan Factory
University of Michigan Press
Ann Arbor, 1997
Die Fliege in der Suppe
Hanser
München, 1997
[Ü: Rudolf von Bitter]
Medici Groschengrab. Die Kunst des Joseph Cornell
Hanser
München, 1998
[Ü: Klaus Martens]
Grübelei im Rinnstein. Ausgewählte Gedichte
Hanser
München, 2000
[Ü: Hans Magnus Enzensberger, Michael Krüger, Rainer G. Schmidt, Jan Wagner]
Wo steckt Pepe?
Hanser
München, 2000
[Ü: Uwe-Michael Gutzschhahn]
The Metaphysician in the Dark
University of Michigan Press
Ann Arbor, 2003
My Noiseless Entourage
Harcourt
Orlando, 2005
Übersetzer
Rudolf von Bitter, Hans Magnus Enzensberger, Uwe-Michael Gutzschhahn, Susanne Höbel, Michael Krüger, Klaus Martens, Wiebke Oeser, Rainer G. Schmidt, Jan Wagner