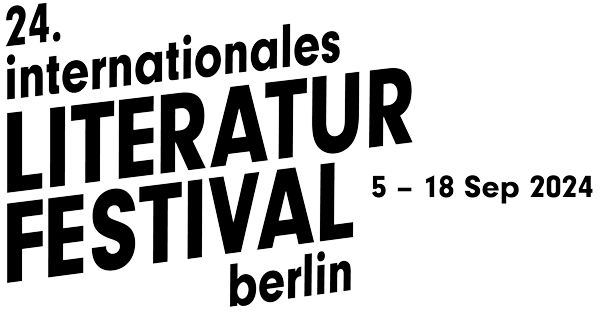Antonio Tabucchi
- Italien
- Zu Gast beim ilb: 2001
Il teatro portoghese del dopoguerra: trent’anni di censura
Abete
Roma, 1976
Il piccolo naviglio
Mondadori
Mailand, 1978
Der kleine Gatsby
ComMedia & Arte
Stuttgart, 1986
Übersetzung: Dagmar Türck-Wagner
I volatili del Beato Angelico
Sellerio
Palermo, 1987
Kleine Mißverständnisse ohne Bedeutung
Hanser
München, 1988
Übersetzung: Karin Fleischanderl
Der Rand des Horizonts
Hanser
München, 1988
Übersetzung: Karin Fleischanderl
I dialoghi mancati
Feltrinelli
Milano, 1988
Un baule pieno di gente: scritti su Fernando Pessoa
Feltrinelli
Mailand, 1990
Indisches Nachtstück und Ein Briefwechsel
Hanser
München, 1991
Übersetzung: Karin Fleischanderl
Herr Pirandello wird am Telefon verlangt: ein versäumter Dialog
Friedenauer Presse
Berlin, 1991
Übersetzung: Karin Fleischanderl
Wer war Fernando Pessoa?
Hanser
München, 1992
Übersetzung: Karin Fleischanderl
Lissabonner Requiem. Eine Halluzination
Hanser
München, 1994
Übersetzung: Karin Fleischanderl
Die Frau von Porto Pim
Wagenbach
Berlin, 1995
Übersetzung: Karin Fleischanderl
Erklärt Pereira
Hanser
München, 1995
Übersetzung: Karin Fleischanderl
Der schwarze Engel
Hanser
München, 1996
Übersetzung: Karin Fleischanderl
Der verschwundene Kopf des Damasceno Monteiro
Hanser
München, 1997
Übersetzung: Karin Fleischanderl
Marconi, se ben mi ricordo
Rai-ERI
Rom, 1997
La gastrite di Platone
Sellerio
Palermo, 1998
Piazza d’Italia
Wagenbach
Berlin, 1998
Übersetzung: Karin Fleischanderl
Träume von Träumen
Hanser
München, 1998
Übersetzung: Karin Fleischanderl
Die letzten drei Tage des Fernando Pessoa
Hanser
München, 1998
Die Roma und die Renaissance
Lettre International 43
Berlin, 1998
Ein Universum ist nur eine Silbe
Lettre International 50
Berlin, 2000
Das Umkehrspiel
Hanser
München, 2000
Übersetzung: Dagmar Türck-Wagner, Karin Fleischanderl
Forbidden Games
Lettre International 53
Berlin, 2001
Die Geschichte der Unruhe
Lettre International 55
Berlin, 2001
Es wird immer später
Hanser
München, 2002
Übersetzung: Karin Fleischanderl
Zichorienkaffee
Lettre International 63
Berlin, 2003
Autobiografie altrui: poetiche a posteriori
Feltrinelli
Milano, 2003
Tristano stirbt
Hanser
München, 2005
Übersetzung: Karin Fleischanderl
Das Vermächtnis der Farben
Lettre International 68
Berlin, 2005
Racconti
Feltrinelli
Mailand, 2005
L’oca al passo [mit Simone Verde]
Feltrinelli
Milano, 2006
Tote bei Tisch
Lettre International 72
Berlin, 2006
Die Manege erwacht
Lettre International 73
Berlin, 2006
Übersetzer: Karin Fleischanderl, Adrian La Salvia, Dagmar Türck-Wagner